
Vorab!
Leider kommt im Internet bei meinem (inzwischen veralteten) FrontPage-Programm längst nicht alles so, wie von mir in html angegeben. Farben kommen anders, als von mir geplant, Satzbreiten wollen nicht so wie von mir markiert, Bilder kommen manchmal an der falschen Stelle, und - wenn ich Pech habe - erscheint statt des Bildes gar eine Leerstelle.
Was tun? Wer kann helfen?
*
Wird laufend bearbeitet!
Wir sind TUWINER: Das Yak-Hirtenehepaar Oorshan hoch oben in den Bergen des Sajan.

Foto: Detlev Steinberg

Zeichnung: Karl-Heinz Döhring
"Die Seele, denke ich, hat keine Nationalität."
Juri Rytchëu (tschuktschischer Schriftsteller, 1930 bis 2008) in: Im Spiegel des Vergessens, 2007
Wenn wir für das eine Volk eine Zuneigung oder gegen das andere eine Abneigung hegen, so beruht das, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, auf dem, was wir von dem jeweiligen Volk wissen oder zu wissen glauben. Das ist – seien wir ehrlich – oft sehr wenig, und manchmal ist dieses Wenige auch noch falsch.
Ich habe für die Berliner Illustrierte FREIE WELT jahrelang die Sowjetunion bereist, um – am liebsten - über abwegige Themen zu berichten: über Hypnopädie und Suggestopädie, über Geschlechtsumwandlung und Seelenspionage, über Akzeleration und geschlechtsspezifisches Kinderspielzeug... Außerdem habe ich mit jeweils einem deutschen und einem Wissenschaftler aus dem weiten Sowjetland vielteilige Lehrgänge erarbeitet.* Ein sehr interessantes Arbeitsgebiet! Doch 1973, am letzten Abend meiner Reise nach Nowosibirsk – ich hatte viele Termine in Akademgorodok, der russischen Stadt der Wissenschaften – machte ich einen Abendspaziergang entlang des Ob. Und plötzlich wurde mir klar, dass ich zwar wieder viele Experten kennengelernt hatte, aber mit der einheimischen Bevölkerung kaum in Kontakt gekommen war.
Da war in einem magischen Moment an einem großen sibirischen Fluss - Angesicht in Angesicht mit einem kleinen (grauen!) Eichhörnchen - die große FREIE WELT-Völkerschafts-Serie** geboren!
Und nun reiste ich ab 1975 jahrzehntelang zu zahlreichen Völkern des Kaukasus, war bei vielen Völkern Sibiriens, war in Mittelasien, im hohen Norden, im Fernen Osten und immer wieder auch bei den Russen.
Nach dem Zerfall der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zog es mich – nach der wendegeschuldeten Einstellung der FREIEN WELT***, nun als Freie Reisejournalistin – weiterhin in die mir vertrauten Gefilde, bis ich eines Tages mehr über die westlichen Länder und Völker wissen wollte, die man mir als DDR-Bürgerin vorenthalten hatte.
Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist nun mein Nachholebedarf erst einmal gedeckt, und ich habe das Bedürfnis, mich wieder meinen heißgeliebten Tschuktschen, Adygen, Niwchen, Kalmyken und Kumyken, Ewenen und Ewenken, Enzen und Nenzen... zuzuwenden.
Deshalb werde ich meiner Webseite www.reller-rezensionen.de (mit inzwischen weit mehr als fünfhundert Rezensionen), die seit 2002 im Netz ist, ab 2013 meinen journalistischen Völkerschafts-Fundus von fast einhundert Völkern an die Seite stellen – mit ausführlichen geographischen und ethnographischen Texten, mit Reportagen, Interviews, Sprichwörtern, Märchen, Gedichten, Literaturhinweisen, Zitaten aus längst gelesenen und neu erschienenen Büchern; so manches davon, teils erstmals ins Deutsche übersetzt, war bis jetzt – ebenfalls wendegeschuldet – unveröffentlicht geblieben.
Sollten sich in meinem Material Fehler oder Ungenauigkeiten eingeschlichen haben, teilen Sie mir diese bitte am liebsten in meinem Gästebuch oder per E-Mail gisela@reller-rezensionen.de mit. Überhaupt würde ich mich über eine Resonanz meiner Nutzer freuen!
Gisela Reller
* Lernen Sie Rationelles Lesen" / "Lernen Sie lernen" / "Lernen Sie reden" / "Lernen Sie essen" / "Lernen Sie, nicht zu rauchen" / "Lernen Sie schlafen" / "Lernen Sie logisches Denken"...
** Im 1999 erschienenen Buch „Zwischen `Mosaik´ und `Einheit´. Zeitschriften in der DDR“ von Simone Barck, Martina Langermann, Siegfried Lokatis (Hrsg.), erschienen im Berliner Ch. Links Verlag, ist eine Tabelle veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Völkerschaftsserie der FREIEN WELT von neun vorgegebenen Themenkreisen an zweiter Stelle in der Gunst der Leser stand – nach „Gespräche mit Experten zu aktuellen Themen“.
(Quelle: ZA Universität Köln, Studie 6318)
*** Christa Wolf zur Einstellung der Illustrierten FREIE WELT in ihrem Buch "Auf dem Weg nach Tabou, Texte 1990-1994", Seite 53/54: „Aber auf keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, in dieser Halbstadt werde nicht mehr gelacht. Im Gegenteil! Erzählt mir doch neulich ein Kollege aus meinem Verlag (Helmut Reller) – der natürlich wie zwei Drittel der Belegschaft längst entlassen ist –, daß nun auch seine Frau (Gisela Reller), langjährige Redakteurin einer Illustrierten (FREIE WELT) mitsamt der ganzen Redaktion gerade gekündigt sei: Die Zeitschrift werde eingestellt. Warum wir da so lachen mußten? Als im Jahr vor der `Wende´ die zuständige ZK-Abteilung sich dieser Zeitschrift entledigen wollte, weil sie, auf Berichterstattung aus der Sowjetunion spezialisiert, sich als zu anfällig erwiesen hatte, gegenüber Gorbatschows Perestroika, da hatten der Widerstand der Redaktion und die Solidarität vieler anderer Journalisten das Blatt retten können. Nun aber, da die `Presselandschaft´ der ehemaligen DDR, der `fünf neuen Bundesländer´, oder, wie der Bundesfinanzminister realitätsgerecht sagt: `des Beitrittsgebiets´, unter die vier großen westdeutschen Zeitungskonzerne aufgeteilt ist, weht ein schärferer Wind. Da wird kalkuliert und, wenn nötig, emotionslos amputiert. Wie auch die Lyrik meines Verlages (Aufbau-Verlag), auf die er sich bisher viel zugute hielt: Sie rechnet sich nicht und mußte aus dem Verlagsprogramm gestrichen werden. Mann, sage ich. Das hätte sich aber die Zensur früher nicht erlauben dürfen! – "Das hätten wir uns von der auch nicht gefallen lassen", sagt eine Verlagsmitarbeiterin.
Wo sie recht hat, hat sie recht.“
Zeichnung: Karl-Heinz Döhring
"Tuwa zieht Reisende wie ein Magnet an. Die Region ist eine Mekka für diejenigen, die Wanderungen in der unberührten natürlichen Umgebung über alles schätzen."
Stimme Russlands vom 21. Januar 2007
Wenn Sie sich die folgenden Texte zu Gemüte geführt und Lust bekommen haben, Tuwinien zu bereisen und die Tuwiner kennenzulernen, sei Ihnen das Reisebüro ? empfohlen; denn – so lautet ein tuwinisches Sprichwort -
Reisen sind Vorhaben, die den Verstand erleuchten.
(Hier könnte Ihre Anzeige stehen!)
Die TUWINER… (Eigenbezeichnung: Sojoten)
Die Tuwiner sind aus der Vermischung turksprachiger Stämme mit türkisierten Keten, Samojeden [Nenzen] und Mongolen hervorgegangen, sie sind eines der ältesten Völker Zentralasiens.
"Die russischen Sojoten [Tuwiner] sind arme Nomaden, und halten wenige Rennthiere und zum Ziehen abgerichtete Hunde. Sie wohnen in elenden Hütten von Birkenrinde, deren Stelle sie oft wechseln, und leben von kümmerlicher Jagd, Fischfang und Wurzeln, die sie aus der Erde graben."
Julius von Klaproth, deutscher Orientalist, Sinologe und Forschungsreisender (1783 bis 1835)
Tuwinien - Kurzbezeichnung: Tuwa, zu Russland gehörig - liegt inmitten des asiatischen Kontinents, an der Grenze zur Mongolei, dort, wo sich die sibirische Taiga und die Wüsten Mittelasiens berühren. Tuwinien ist seit 1990 für Ausländer offen (Wir FREIE WELT-Journalisten hatten schon 1983 das Glück, einreisen zu dürfen!) Auch heute noch ist Tuwa sogar für viele Russen ein unbekanntes Buch mit sieben Siegeln am Rande der Welt.
"Im Innersten Asiens gibt es ein kleine Turkvolk, von dem man bei uns noch recht wenig weiß. Seine Angehörigen nennen sich Tywa oder Dywa, und danach bezeichnen wir sie als Tuwiner. (...) ´Bis unser Jeep in einer Staubwolke verschwindet, werden unsere tuwinischen Freunde noch vor der Jurte stehen und uns nachschauen - natürlich trockenen Auges, damit nicht Tränen zum Hindernis werden auf unserem Weg."
Dr. Erika Taube (geboren 1933), die "tuwinische Deutsche"
Bevölkerung: Nach der Volkszählung von 1926 zählten die Tuwiner angeblich 200 Angehörige; 1939 wurden angeblich 794 Tuwiner gezählt; 1959 waren es realistische 99 864 Tuwiner; 1970 gleich 139 013; 1979 gleich 165 426; 1989 gleich 206 960; 2002 gleich 243 442; nach der letzten Volkszählung von 2010 gaben sich 263 934 Personen als Tuwiner aus. Die Tuwiner sind eine der größten Minoritäten in Sibirien und leben, wie nur noch die Jakuten in der Republik Sacha, in einem autonomen Gebiet Sibiriens und stellen gegenüber den Russen mit 81,0 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung. - Seit den 1990er Jahren sind viele Russen abgewandert; ihre Anzahl hat sich von 1989 bis 2010 halbiert: Lebten in Tuwinien 1989 noch 98 831 Russen, so waren es 2010 nur noch 49 434. Kleinere Minderheiten sind die Chakassen (0,3 Prozent) und die Ukrainer (0,2 Prozent). Nur etwa 8 Prozent der Tuwiner lebt außerhalb ihrer Republik. Tuwinien ist so dünn besiedelt - 1,8 Einwohner pro Quadratkilometer -, dass in einigen Gegenden auf jeden Einwohner mehr als sieben Quadratkilometer unberührte Taiga entfallen.
"Die Tuwiner sind das einzige Volk Sibiriens, das in seiner Region eine nationale Mehrheit darstellt. Und zwar eindeutig, denn auf 314 000 Einwohner kommen nur 30 000 Russen."
Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014
Fläche: Die Fläche Tuwiniens, gelegen im Süden Ostsibriens, beträgt 170 500 Quadratkilometer. Obwohl Tuwa weniger als ein Prozent des Territoriums der ehemaligen Sowjetunion einnimmt, hätten auf tuwinischer Fläche Dänemark, Holland, Belgien und die Schweiz Platz. Tuwinien ist eine der unzugänglichsten Regionen der Russischen Föderation und wird begrenzt im Westen vom Gebiet Gorno-Altai, im Nordwesten durch die Krasnojarsker Region und die Republik Chakassien, im Nordosten durch das Irkutsker Gebiet und die Republik Burjatien (alle zu Russland gehörig) und im Süden und Südosten durch die Mongolei.
Geschichtliches: In der Antike lebten auf heutigem tuwinischem Gebiet skythische Stämme mit hoher Kultur. Im Jahre 744 wurde ein uigurischer Staat errichtet; einer der 15 Uigurenstämme wurde Tuba (Tuwa) genannt. Seit dem 7. Jahrhundert standen die als Jägernomaden am oberen Jenissej und seinen Zuflüssen lebenden Tuwiner zunächst unter der Herrschaft der Chinesen. Diesen folgten als Eroberer die Uiguren und Jenissej-Kirgisen. Vom 13. (1207) bis zum 17. Jahrhundert gehörten die Gebiete der Tuwiner zum Machtbereich mongolischer Herrscher, die von den Kalmyken [Kalmücken] verdrängt wurden. Das expandierende Mandschu-Reich brachte schließlich die Tuwiner in der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder unter chinesische Herrschaft - mit dem Vertrag von Kjachta. 1758 bis 1911 war Tuwa Provinz des chinesisch-mandschurischen Kaiserreichs unter der Quing-Dynatie und wurde von chinesischen Gouverneuren regiert.
"In grauer Vorzeit lebte in den Regionen des heutigen Tuwa und des benachbarten Chakassien ein hochkultiviertes Volk.. Es baute Städte und Paläste, trieb Handel mit aller Welt, es konnte rechnen, schreiben und lesen, seine Kunstwerke waren berühmt und begehrt vom Jenissej bis zum Bosporus - was war das für ein Volk? Ein skythisches, ein türkisches, ein mongolisches? Seine Spuren sind verweht in den Jahrtausenden wechselvoller Geschichte, und nur die Archäologen stehen ab und zu und immer wieder staunend vor den steinernen oder metallenen Zeugnissen seiner vergessenen Existenz. Urjanchai nannten die benachbarten Mongolen alle Völker, die im Walde lebten, und Urjanchaisk nannten die benachbarten Russen die bergige Waldgegend des heutigen Tuwa, in der die Kirgisen herrschten und die Uiguren, die Mongolen und die Chinesen, über die die Stürme der Völkerwanderung hinwegfegten und zugrund richteten, was dort einst blühte."
Egon Richter in: Im Land der weißen Kamele, 1986
Die ersten Kontakte zwischen Tuwinern und Russen kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zustande, als die Chinesen 1860 dem russischen Reich Handelsrechte in dem als Tuwa oder auch Urjanchaj bezeichneten Gebiet der Tuwiner eingeräumt hatten. 1863/65 erfolgte ein Volksaufstand gegen die mandschurische Unterdrückung - er ging als "Aufstand der sechzig Recken" in die Legenden- und Märchenwelt der Tuwiner ein. 1864 verzichtet Russland im Vertrag von Tschungutschag formell auf seine strittigen Ansprüche aus dem Vertrag von Kjachta und erhielt dafür das Ussuri-Gebiet im Fernen Osten. Seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ließen sich auf tuwinische Erde immer mehr russische Siedler nieder, die sozusagen die 1914 offiziell vollzogene Eingliederung Urjanchajs in das russischer Reich vorwegnahmen. 1911 erfolgte die Beseitigung des Kaiserreichs und die Errichtung der bürgerlichen Republik in China; die Mongolei wurde ein selbständiger Staat und das Territorium Tuwas von China getrennt. 1912 vertrieb Tuwas Bevölkerung die chinesischen Händler, Russland sandte Kosaken nach Urjanchai. Am 21.10.1912 wurde Tuwa als Gebiet Urjanchai vertraglich der Schutzherrschaft des Russischen Reiches unterstellt, behielt aber Sonderrechte: Der lamaistische Buddhismus blieb Staatsreligion, das Nomadentum wurde beibehalten, die Tuwiner blieben von der Militärdienstpflicht befreit.
"Die Feudalherren besaßen die Gebiete und Weiden der Nomaden und die dazu gehörenden Araten, die Leibeigenen. (...) Zu dieser Zeit bemühte sich sowohl Rußland als auch China um Tuwa. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts begannen die Russen hier zu siedeln. Da die chinesische Verwaltung eine schwere Last für das Land bedeutete, scheinen sich die einfachen Tuwiner mehr zu den Russen hingezogen gefühlt zu haben, während die tuwinischen Feudalherren den Chinesen den Vorzug gaben."
Lexikon, Wiesbaden 1978
Im August 1914 wurde Urjanchai administrativer Verwaltungsteil des russischen Gouvernements Jenissej. 1918/21 tobte auch in Tuwinien der revolutionäre Bürgerkrieg zwischen Weißen und Roten. Am 13.8.1921 wurde die unabhängige Tuwinische Volksrepublik proklamiert, die sich ab 1926 Tannu-Tuwa nannte. Von 1941 bis 1945 kämpften zahlreiche Tuwiner im Großen Vaterländischen Krieg freiwillig in der Roten Armee.

Tuwiner während des Großen Vaterländischen Krieges als Freiwillige in der Roten Armee.
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
Der sich seit 1930 verstärkende sowjetische Einfluss auf die Politik der Republik der Tuwiner hatte nach einem formellen Aufnahmeantrag im Oktober 1944 zu deren Eingliederung in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken als Tuwinisches Autonomes Gebiet geführt. Westliche Geheimdienste sollen drei Jahre benötigt haben, um wahrzunehmen, dass es einen unabhängigen Staat Tannu-Tuwa nicht mehr gab. 1961 wurde das Tuwinische Autonome Gebiet zu einer Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik aufgewertet.
"Seit der Aufnahme in die Sowjetunion hat sich vieles geändert. Die Schulpflicht wurde eingeführt, und die Menschen wurden in Kollektiven angesiedelt, wo sie ihr Vieh auf verbesserten Weiden aufziehen und intensiveren Ackerbau durch systematische Bewässerung des Landes sowie durch Einführung neuer Getreidesorten betreiben konnten."
Lexikon, Wiesbaden, 1978
Staatsgefüge: Am 13.8. 1921 erfolgte die Proklamierung der unabhängigen Volksrepublik Tannu-Tuwa. Das Gebiet der Tuwiner wurde nach der Sowjetunion der zweite sozialistische Staat der Welt, drei Jahre vor der Gründung der Mongolischen Volksrepublik. Am 9.9.1921 verzichtete Sowjetrussland feierlich auf alle Ansprüche des ehemaligen zaristischen Russischen Reiches auf Urjanchai und erkannte die Volksrepublik Tannu-Tuwa als selbständigen Staat an. Es begann die allseitige Hilfeleistung und Unterstützung Sowjetrusslands für Tuwa. 1925 wurde ein Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und Tuwa geschlossen. Erster Präsident des Landes war Donduk Kuular (1888 bis 1932). Er war es, der den Buddhismus zur Staatsreligion bestimmte und den Zuzug russischer Siedler limitierte. Donduk Kuular war lamaistischer Mönch. Er schloss sich einer Gruppe von „Nationalbolschewisten“ an, die 1921 mit sowjetrussischer Unterstützung die Unabhängigkeit Tuwas ausriefen. 1929 inszenierte die Sowjetunion einen kommunistischen Staatsstreich in Tuwa. Donduk Kuular wurde als Ministerpräsident abgesetzt, verhaftet und später durch Saltschak Toka (1901 bis 1973) ersetzt. Dieser wurde am 6. März 1932 auch Generalsekretär der Revolutionären Volkspartei von Tuwa und war von 1932 bis 1944 Regierungschef der Tuwinischen Volksrepublik. 1929 wurde Donduk Kuular (wohl auf Geheiß Stalins) verhaftet und 1932 hingerichtet. 1944 wurde Tannu-Tuwa in Tuwinische Volksrepublik umbenannt und war damit das jüngste Staatsgebilde innerhalb der Sowjetunion. Präsident der Republik Tuwa ist seit 2011 Scholban Kara-ool (geboren 1966). Er hat Philosophie, Politologie und Soziologie an der Staatlichen Universität in Swerdlowsk studiert.
Vorgänger Scholban Kara-ools war seit 2001 der Senator Pugatschow, ein Petersburger Oligarch, der sich allerdings 2008 das letzte Mal in Tuwinien sehen gelassen hatte, was den Gouverneur von Tuwa veranlasste, ihn 2011 seines Amtes zu entheben. Bleibt nachzutragen, dass besagter Gouverneur Scholban Kara-ools war.

Donduk Kuular, erstes Staatsoberhaupt des unabhängigen Tuwinien, 1932 hingerichtet.
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
Verbannungsgebiet: Auch in Tannu- Tuwa kam es in den Dreißiger Jahren zu Rotem Terror, der allerdings nicht ganz so rigoros ausfiel wie in der Sowjetunion.
„Von Zeit zu Zeit rollen streng bewachte Züge mit russischen und deutschern Technikern oder KZ-Häftlingen in Richtung Tannu-Tuwa. Die Republik verschlingt alle diese Menschen. Mit Ausnahme einzelner hoher Offiziere und gewisser Gelehrter kehrt niemand mehr zurück.“
In: Der Spiegel vom 9. Oktober 1948
Der einzige GULAG in Tuwa bestand von Mai 1952 bis April 1953 bei Kysyl-Mashalyk. Hier wurden 1 400 Gefangene in der Asbestmine beschäftigt. Seit den politischen Wirren Anfang der 1990er Jahre des 20. Jahrhunderts steht diese Asbestfabrik still.
Hauptstadt: Kysyl. Die Stadt wurde 1914 als Belozarsk – Stadt des weißen Zaren - gegründet. 1918 wurde die Stadt umbenannt in Urjanchaisk, erhielt 1920 den Namen Krasny ("die Rote") und 1926 ihre jetzige tuwinische Bezeichnung Kysyl ("die Rote"). Kysyl hat 109 918 Einwohner (2010) und liegt 631 Meter über dem Meer am Zusammenfluss von Großem und Kleinen Jenissej; hier nimmt der eigentliche Jenissej seinen Lauf.
"Die eifersüchtigen Bewunderer der Wolga mögen es mir verzeihen, wenn ich sage, dass ich in meinem Leben keinen prächtigeren Fluss als den Jenissej gesehen habe. Wenn die Wolga eine elegante, bescheidene und schwermütige Schönheit ist, so ist der Jenissej ein mächtiger, ungestümer Recke, der nicht weiß, wohin mit seiner Kraft und Jugend."
Anton Tschechow, (russischer Schriftsteller, Novellist und
Dramatiker, 1860 bis 1904)
In Kysyl befindet sich der geographische Mittelpunkt Asiens: Von hier aus ist es gleich weit bis zum Bosporus oder zur Beringstraße, bis zum Kap Tscheljuskin oder nach Singapur. - Kysyl hat zwei Museen, vier große Bibliotheken, ein Theater, eine Philharmonie, zwei Kulturpaläste, zwei Hochschulen (eine pädagogische und eine polytechnische), vier Kinos, zwei Sportstadien, ein Hypodrom, zwei Restaurants, zehn Warenhäuser, eine Schiffsanlegestelle und - natürlich - ein Lenindenkmal (insgesamt stehen in Tuwa sechzehn Denkmäler und Gedenkstätten, die an die "unverbrüchliche Freundschaft mit dem großen russischen Brudervolk" erinnern).
Wirtschaft: In den zwanziger Jahren bestand die tuwinische Industrie aus Handwerksbetrieben zur Bearbeitung von Fellen, einer Werkstatt zur Instandsetzung von Pferdewagen und mehreren Goldgruben. Heute ist Tuwinien eine Agrar-Industrie-Republik. Der führende Zweige der Landwirtschaft ist die Viehzucht: Feinwollschaf- und Rinderzucht, traditionelle Pferdezucht, Yaks im Hochgebirge, Rentiere im Nordosten des Landes, Kamele bei Samagaltai. Schnell entwickelten sich auch die Schweinezucht und die Geflügelhaltung. - Hauptanbaukulturen sind Getreide (Weizen) und Futterpflanzen. Der gegenwärtige Trend: Getreideflächen werden wieder Weidegebiete. Ein Teil der Anbaufläche wird bewässert. Bedeutungsvoll sind die Pelztierjagd und die Pelztierzucht (Zobel, Polarfuchs, Biber, Nerz). Heute werden in der Region über zweihundert Vorkommen an Bodenschätzen erschlossen, u . a. Gold, Kobalt, Asbest, Kupfer, Quecksilber, Eisenerz, Steinkohle; 1944 wurden in Tuwa Uranvorkommen entdeckt. Eines der größten Unternehmen der Republik ist “Tuwa-Asbest”. Asbest, der sogenannte Bergflachs, wird, obwohl in Verruf geraten, auch heute noch bei der Herstellung von feuerfesten und Wärme dämmenden Erzeugnissen eingesetzt. Aber die führende Industriebranche des modernen Tuwinien ist das Metallhüttenwesen, das auf der Gewinnung von Gold basiert. Etwa zwei Tonnen Gold gewinnen tuwinische Goldsucher-Genossenschaften jährlich. Neben dem Bergbau und der Rohstoffverarbeitung sind die Lebensmittelindustrie, die Holzgewinnung und Holzverarbeitung, sowie die Leder- und Baustoffindustrie von Bedeutung. - Der Sajano-Schuschensker Stausee bzw. die Sajano-Schuschensker Talsperre besitzt mit dem Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskoje am Jenissej das größte Wasserkraftwerk Russlands. Der Stausee liegt in der Republik Chakassien, der Region Krasnojarsk und der Republik Tuwa. Stausee und Kraftwerk – gebaut von 1963 bis 1988 - wurden nach dem umliegenden Sajangebirge sowie nach dem symbolträchtigen Ort Schuschenskoje benannt, in dem sich Staatsgründer Lenin von 1897 bis 1900 in der Verbannung befand. Für den Stausee wurden 35 600 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und 2 717 Häuser geflutet. Der See ist 320 Kilometer lang, stellenweise mehr als zehn Kilometer breit und 113 Meter tief. Sein Stauinhalt beträgt 31,3 Milliarden Kubikmeter. Boris Jelzin, der damalige Präsident, privatisierte das Wasserkraftwerk 1993. Damals musste Chakassien auf seinen Teil der Aktien verzichten und erhielt dafür das Recht, im Laufe von zehn Jahren die Elektroenergie zu einem Vorzugspreis zu kaufen. Im September 2004 lief dieses Abkommen aus. Der Gouverneur Chakassiens, Alexej Lebed (Bruder des bekannten Politikers und Generals Alexander Lebed, 2002 mit dem Hubschrauber verunglückt - reichte Klage ein, das Privatisierungsgeschäft für ungültig zu erklären und das Werk wieder zu verstaatlichen. Gleichzeitig schlug er einen Kompromiss vor, wonach die Preisvergünstigung für Chakassien bis 2020 verlängert werden sollte. Lebeds Vorschlag wurde abgelehnt. - Der größte Abnehmer der vom Sajan-Wasserkraftwerk Schuschenskoje produzierten Elektroenergie ist das Aluminiumwerk Sajan, das dem Milliardär Oleg Deripaka gehört.
Verkehr: Nur zwei Gebirgsstraßen - Minussinsk-Kysyl (Ussinsker Trakt) und Ak-Dowurak-Abasa - durchziehen das Land Tuwinien. Der wichtigste Verkehrsweg ist der Ussinsker Trakt, der 436 Kilometer lang ist. Der Bau der Straße zog sich von 1911 bis 1917 hin, erst 1932 wurde sie nach einer Rekonstruktion für den Autoverkehr freigegeben. Noch hat Tuwinien keinen Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn, so dass sich der Verkehr auf "Gummireifen" abspielt. Nach Kysyl gelangt man vor allem mit dem Flugzeug.
"Tuwa hat keine Eisenbahn, noch nicht einmal Nachbarn. Es ist umgeben von mit Taiga bewachsenen, menschenleeren Bergen. Auf der einen Seite das Sajan-Gebirge, auf der anderen der Altai, und im Süden die wilden mongolischen Steppen. (...) Es ist so ein Kaff, dass nicht mal einer der weltweiten Fritten- und Hamburgerverkäufer hier seine Filiale eröffnet hat."
Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014
Sprache/Schrift: Das Tuwinische gehört zur uigurischen Gruppe der östlichen Turksprachen. - Es ist weithin unbekannt, dass die türkische Sprache (oder besser: die Gruppe der Turksprachen) nach dem Russischen im russischen Imperium die zweitwichtigste Sprache ist. Rund sechzig Millionen sprechen diese Sprache. Ein Aserbaidschaner kann sich nicht nur in Ankara verständigen, sondern auch in Taschkent und in Jakutsk. Die Sowjetunion war gewissermaßen ein sowjetisch-türkisches Großreich. Solschenizyn hatte die Idee, das türkische Element loszuwerden, um ein slawisches Großreich zu erhalten. - Die wichtigsten sibirischen Turksprachen sind neben dem Tuwinischen Chakassisch, Dolganisch, Jakutisch. - Amtssprachen sind in Tuwinien Tuwinisch und Russisch. In den 20er und 30er Jahren ging es darum, für die Tuwiner eine Schrift zu "erfinden."
"Man hatte mir schon in Kysy-choto von der neuen Schrift erzählt. In wenigen Jahren, versichert man mir, werden alle Kinder lesen und schreiben können. Heute wird in Tuwa nur mongolisch geschrieben, die einzige Zeitung des Landes erscheint in mongolischer Sprache, welche Sprache nicht einmal zwei Prozent der Bevölkerung beherrschen. (...) Es galt also, eine neue Schrift zu erfinden. Der berühmte Leningrade Sprachforscher Poppe wurde von der tuwinischen Regierung damit beauftragt. Sein Vorschlag, wohldurchdacht und der Eigenart der Sprache Rechnung tragend, wurde aber abgelehnt. Man fand, er habe zu viele Zeichen erfunden. (...) Und so nahm man das System des Lama Lobsan Dschigmid an, das zwar höchst mangelhaft war, aber mit den gebräuchlichen lateinischen Zeichen auskommt."
Otto Mänchen-Helfen in: Reise ins asiatische Tuwa, 1931
1930 begründete der Belorusse Professor Alexander Palmbach dann die tuwinische Schriftsprache auf der Basis des lateinischen (seit 1938/39, nach anderen Quellen seit 1940 des kyillischen) Alphabets, auf deren Grundlage die tuwinische Schrift bis heute beruht; das Tuwinische hat drei zusätzliche Zeichen.
seit 1940 wird auch die tuwinsche Schriftsprache mit kyrillischen Schriftzeichen realisiert,
Literatursprache/Literatur: Das Tuwinische ist heute Literatursprache. Das erste Prosawerk in Tuwinisch ist die "Erzählung der Sambukai" - eine Geschichte von der Entsklavung der Frau, geschrieben von Saltschak Toka, Alexander Palmbach (dem Begründer der tuwinischen Schriftprache und Michail Mochow.

1985: Der Tuwinische Buchverlag gibt jährlich über achtzig Titel heraus.
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
Bildung: 1944 wurden in Tuwa 9 300 Schüler gezählt, in den 1980er Jahren sind es 65 000. Auf eintausend in der Volkswirtschaft Beschäftigte entfallen 802 Personen mit Oberschul-, Fach- oder Hochschulbildung. 1945 war das Staatliche Tuwinische Wissenschaftliche Komitee in ein reguläres akademisches Institut umgewandelt worden, das in kürzester Zeit acht Lehrbücher herausbrachte. Bereits 1947 konnte die Mittelschule mit dem Abitur abgeschlossen werden. 1952 hatte das Institut sechs wissenschaftliche Mitarbeiter, 1985 hatte es 64, davon sind vier habilitierte und 34 promovierte Doktoren, von letzteren gibt es in Tuwa inzwischen bereits 70. Das Institut verfügt seit 1985 über eine Sprach- und Schriftabteilung.

In einer Mittelschule Samagaltais; für die Mädchen ist Kochunterricht obligatorisch.
Foto: Detlev Steinberg
Kunst/Kultur: Die Mannigfaltigkeit der Denkmäler aus verschiedenen Epochen überrascht selbst Fachleute. Buchstäblich auf Schritt und Tritt trifft man in Tuwinien, dem “Land der Berge”, alte Felszeichnungen und geheimnisvolle steinerne Figuren. In Tuwinien gibt es etwa zwanzigtausend Grabhügel, viele davon älter als die ägyptischen Pyramiden. Die ausgegrabenen Schätze eines der Grabhügel aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. haben für großes Aufsehen gesorgt. Eine deutsch-russische archäologische Gruppe hat eine Vielzahl von Goldschmuck ausgegraben, dessen Gesamtgewicht auf fast zwanzig Kilo geschätzt wird: goldene Figürchen, die in skythischem “Tierstil” angefertigt wurden, rekonstruierte festliche Gewänder und viele andere Funde aus diesem Grabhügel sind heute im größten russischen Museum – in der Petersburger Eremitage - zu sehen. - Die Tuwiner sind berühmt für ihre aus Speckstein geschnitzten Figuren, meist Tierfiguren. Die tuwinische volkstümliche Bildhauerei wird auf dem Weltmarkt hoch geschätzt. - Auch die Schmiedekunst ist bei den Tuwinern weit verbreitet.
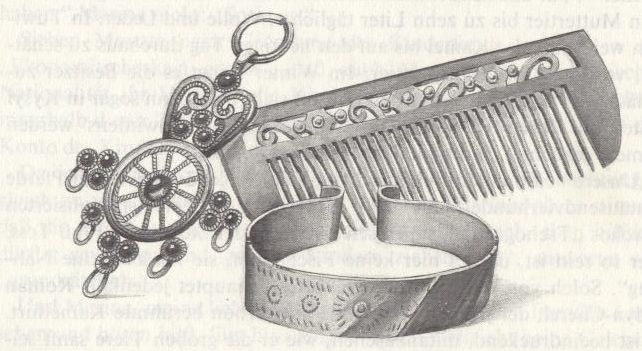
Silberne Ohrgehänge; hölzerner Kamm;
geschmiedete Armspange, 18./19 Jahrhundert.
Zeichnung: Karl-Heinz Döhring
Gesundheitswesen: Eine Geißel in Tuwinien war die Syphilis. Otto Mänchen-Helfen schreibt 1931: "Die Syphilis ist nicht erst von den Russen eingeschleppt worden. Wie zu den benachbarten Mongolen, ist sie auch zu den Tuwinern aus China gekommen. Die Burjäten [Burjaten] am Baikalsee waren schon durchseucht, bevor noch der erste Russe Ostsibirien betreten hatte. Zweifellos haben übrigens die buddhistischen Mönche nicht wenig zur Ausbreitung der Syphilis beigetragen."
"Zu dieser Zeit kurierten sich die Menschen noch nach Art der Urgroßväter. Hast du dich verwundet oder verbrannt, dann streue Haarasche auf die schmerzende Stelle oder leg Heilkräuter auf, denn zum Lama konnte ein Armer nicht gehen, und der Schamane war ebenso teuer."
Saltschak Toka in: Das Wort des Arat, 1951
"Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in Tuwinien bis 1984 von 49 auf 70 Jahre erhöht. Jährlich werden in Tuwinien je eintausend Einwohner 29 Kinder geboren, das ist nach Dagestan die zweithöchste Geburtenzahl der Russischen Föderation. Mitte der 40Jahre des 20. Jahrhunderts gab es in Tuwinien 26 Ärzte, 1985 sind es rund eintausend, das sind 34 Ärzte je zehntausend Einwohner. - Die Lebenserwartung in Tuwinien gehört in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit 56,4 Jahren zu den niedrigsten innerhalb Russlands; 1994 fiel die Lebenserwartung der Männer unter 50 Jahre. - Viele Heilquellen sind nach ihren therapeutischen Kureigenschaften mit denjenigen im Kaukasus und auf der Krim vergleichbar. Bis jetzt gibt es zwei Sanatorien. Die Sanatorien werden vorrangig von Patienten aus den Städten Moskau, St. Petersburg und aus Burjatien, dem Gebirgs-Altai und – der Mongolei besucht.
„Ein betrunkener Ewenke, Burjate, Mongole, Tuwiner, Tschuktsche ist ein besonders unangenehmer Anblick. Zuerst muss man sagen, dass ihn eine Dosis umhaut, nach der ein Russe, Pole, ja sogar ein Deutscher seelenruhig Auto fährt - er aber wälzt sich auf der Straße. Die nordasiatischen Völker vertragen sehr wenig Alkohol."
Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014
Klima: Das Klima ist extrem kontinental, die durchschnittlichen Temperaturschwankungen betragen fast 100 Grad. Im Winter sinken die Temperaturen bis 60 Grad unter Null, während sie im Sommer auf 40 Grad plus steigen können. Niederschläge fallen spärlich - an etwa dreihundert Tagen im Jahr scheint die Sonne.
„Gerade im hohen Norden zeigt sich, wie verheerend die Auswirkungen des Klimawandels sein können. Nördlich des Polarkreises leben mehr als dreißig [vierzig bis fünfzig] indigene Völker – viele davon in Sibirien – von der Jagd, der Rentierhaltung, vom Fischfang und vom Sammeln. ÜberJahrhunderte konnten sie ihre Lebensweise den sich wandelnden Umweltbedingungen anpassen. Jetzt droht den rund vierhunderttausend Ureinwohnern die Vernichtung ihres arktischen Lebensraums. Denn hier vollzieht sich der Klimawandel, der in erster Linie in den Industriestaaten verursacht wird, zwei- bis dreimal schneller als im globalen Durchschnitt. Höhere Temperaturen lassen das ewige Eis schmelzen und verändern die Lebensbedingungen für Mensch und Natur. Die Folgen: Die Ureinwohner müssen zusehen, wie ihre Jagdbeute ausstirbt und wichtige Pflanzen nicht mehr wachsen. Die schützende Schneedecke schmilzt zu früh, so dass die Rentiere nur noch verkümmertes Rentiermoos vorfinden. Menschen sterben, weil vertraute Wege auf dünnerer Eisdecke nicht mehr sicher sind. Ganze Dörfer mussten schon aufgrund von Küstenerosion und Stürmen umgesiedelt werden.“
Verein pro Sibiria e. V., München
Natur/Umwelt: Tuwinien ist ein Gebirgsland, eingeschlossen von den Bergketten des West- und Ostsajan und dem Tannu-ola-Gebirge, die höchste Erhebung ist Mungun Taiga mit 3 976 Metern. Es herrscht Steppenvegetation vor, in den Gebirgen Taiga. Ein Sechstel der Fläche der Republik ist bewaldet (mit sibirischer Lärche, Zeder, Kiefer, Tanne, Pappel, Espe).
"Die Kraft und der Zauber der Taiga liegen ... darin, dass nur die Zugvögel wissen, wo sie zu Ende ist."
Anton Tschechow (russischer Schriftsteller, 1860 bis 1904)
Pflanzen- und Tierwelt: In Tuwinien gibt es 1 500 Pflanzenarten, davon sind 15 endemisch. Federgrassteppen, dichte Taiga, Tundra und Alpenwiesen finden sich und auch eine waldbedeckte Gebirgslandschaft mit Waldsteppen-, Steppen- und Halbwüstengebieten. - Außergewöhnlich vielfältig ist die Tierwelt. In Tuwinien existieren über siebzig Tierarten, 240 Vogelarten und sieben Kriechtierarten. Tuwa ist das einzige Land auf der Erde, im dem sowohl klirrenden Frost gewöhnte Rentiere als auch warmblütige Kamele in freier Natur leben. - Im Winter 2010 randalierte in der Republik Tuwa ein Braunbär zunächst in der Hauptstadt Kysyl und tötete in einem Nachbarort ein Schwein. Als der Bär dann auch Menschen angriff, wurde er erschossen. Nach einem ungewöhnlich trockenen Sommer fanden die Bären nicht genug Nahrung.
Behausungen: Die traditionelle tuwinische Hirtenwohnung ist die Jurte, ähnlich die der Mongolen. Den Filz, mit dem die Jurte bedeckt wurde, stellten die Tuwiner in einem langen, mühsamen Prozess her, wobei die Wolle erst erhitzt und dann gewaschen und gewalzt wurde. Auch im Innern war die Jurte nach mongolischem Vorbild eingerichtet, mit der linken Seite für den Mann, mit der rechten für die Frau. Der heiligste Platz lag gegenüber der Tür, hier wurden schamanistische Bilder aufgestellt. In den Zelten aus Birkenrinde und den Holzhütten, die die Tuwiner im Sommer bewohnten, war die Einteilung die gleiche. Heute benutzen die Tuwiner die kegelförmigen Zelte aus Birkenrinde nur noch als Aufbewahrungslager für Lebensmittel und Kleidung.
Der Lebensstandard ist in Russland regional sehr unterschiedlich hoch. Während besonders in Moskau und St. Petersburg einige Viertel in neuem Glanz erstrahlen, ist in anderen Regionen die Armut nach wie vor groß. In Tschetschenien und Dagestan leben mehr als die Hälfte der Menschen in Armut; weitere arme Regionen sind Inguschetien, Tuwa, Kabardino-Balkarien, Mari El, Kalmykien, Burjatien, der Altai und Mordwinien.
Ernährung: Zur Ernährung wurden vorrangig Rinder, Schafe und Ziegen gehalten. Hauptnahrungsmittel waren Milch und Fleisch der Herden, teilweise wurde die Ernährung durch die Jagd und das Sammeln von Früchten, Nüssen oder Zwiebeln sowie durch Fischfang ergänzt.

Kommt ein weit gereister Gast, wird ihm zu Ehren ein Hammel geschlachtet. Ganz links Autorin Gisela Reller.
Foto: Detlev Steinberg
Kleidung: Typisch für die traditionelle Tracht der Tuwiner (wie für die Mongolen, ihren Nachbarn) ist der "Ton", ein (meist langer) Mantel mit langen Ärmeln, der in der Art des Schnittes bei Männern, Frauen und Kindern ganz ähnlich ist. Wurde der Sommermantel aus "Dalemba" (eine chinesische Stoffart) genäht, so trugen die Tuwiner im Winter diese Mäntel gleichen Schnitts aus Rentierfell. Die Hosen der Männer waren meist aus Schaffell, die der Frauen aus Stoff oder Rentierfell, denn den Frauen war das Tragen von Haustierfellen verboten. Typisch tuwinisch (und mongolisch) ist die kegelförmige Kopfbedeckung

Seit eh und je legen die Tuwiner besonderen Wert auf bequeme Fußbekleidung, denn - so lautet ein tuwinisches Sprichwort - was nützt die Weite der Welt, wenn die Stiefel drücken...
Zeichnung: Gisela Röder in der Illustrierten "FÜR DICH" 4/1983; Rücktitelserie
"Trachten der Völker der Sowjetunion" von "Gast"redakteurin Gisela Reller
Folklore: Auf meiner Tuwinien-Reise kaufte ich mir drei Schallplatten mit tuwinischer Folklore, erschienen bei "Melodija" 1981. Eine Platte ist ganz dem Kehlkopfgesang, dem "Chöömej", gewidmet. Dieser Kehlkopfgesang ist sozusagen die Visitenkarte der Tuwiner. Die Besonderheit dieses Gesangsstils besteht darin, dass der Sänger nicht eine, sondern gleichzeitig zwei oder auch drei Melodien von sich geben kann. In den Notizen eines europäischen Reisenden ist zu lesen: “Der Sänger saugt so viel Luft ein, wie seine Lungen fassen können, und dann beginnt er ein seltsames knurrendes Röcheln aus seinem Eingeweide herauszuziehen“. Knurrendes Röcheln? Ich lausche diesem Gesang - "der Perle tuwinischen Gesangs" - immer wieder hingerissen. - Die erste Schallplatte mit tuwinischer Folklore war übrigens bereits 1934 erschienen, von sowjetischen Kunstwissenschaftlern zusammengestellt.
Feste/Bräuche: Einige Volksfeste des Schamanentums bestehen bis auf den heutigen Tag, wobei sie ihre religiöse Sinngebung weitgehend eingebüßt haben. Während dieser Feste werden wie in alten Zeit Reiterturniere und Wettkämpfe im nationalen Ringsport, dem "Churesch", ausgetragen. Vor und nach dem Wettkampf führen die Ringer noch immer den sogenannten "Adlertanz" auf: sie tänzeln, hüpfen auf einem Bein und vollführen Armbewegungen, die Adlerschwingen imitieren.
Religion: Dem Glauben nach sind die Tuwiner (sofern sie gläubig sind) Buddhisten - genauer gesagt Lamaisten. Der Lamaismus ist die tibetische Sonderform der buddhistischen Religion. Der Buddhismus setzte sich seit Ende des 16. Jahrhunderts in Tuwa mehr und mehr durch und verdrängte den örtlichen Schamanenkult. 1586 wurde das erste buddhistich-lamaistische Kloster errichtet. 1929 gab es 25 buddhistische Klöster und ungefähr 4 000 Lamas und Schamanen. Unter Donduk Kuular, dem ersten Regierungschef Tuwas, war der Buddhismus 1929 Staatsreligion geworden, unter den Sowjets waren die Tempel zerstört, die Lamas größtenteils ermordet worden. Schon 1931 gab es gerade noch ein buddhistisches Kloster, 15 Lamas und ungefähr 725 Schamanen. Nach dem zweiten Weltkrieg sollen noch etwa einhundert tuwinische Lamas gelebt haben, über die allerdings nichts weiter bekannt ist.
„Zwei Eigenschaften haben die Tuwiner berüchtigt gemacht (…): Kleptomanie und Schmutzigkeit. Am ersten Übel ist die zahlenmäßige Schwäche gegenüber äußeren Feinden schuld. Die Tuwiner versuchten Eindringlinge deshalb immer gern durch Diebstähle und Hinterhalt statt durch offenen Kampf zu verscheuchen. Schuld am zweiten Übel ist die Religion der Tuwiner. Sie haben die Reinheit des Wassers zu achten. Der Tuwiner entkleidet sich nicht, wäscht sich nicht, badet nicht. Wird er hierauf angesprochen, so läßt er die 108 Perlen des buddhistischen Rosenkranzes durch seine dreckigen Finger rieseln und antwortet: `Meine Religion verbietet es mir.´"
In: Der Spiegel vom 9. Oktober 1948
- Seit 1990 existiert in Tuwa wieder eine religiöse Gemeinde. Im Februar 1992 wurde im Kysyl-Dag wieder ein buddhistischer Tempel eröffnet. Aus diesem Anlass übergab der hoch betagte Lama Dongak wertvolle Gegenstände, die er seit 1921 versteckt hatte. Im Jahre 1993 besuchte das politische und religiöse Oberhaupt des tibetischen Lamaismus, der Dalai-Lama XIV, Tensin Gyatso, die Tuwinische Republik.

Vor Jahrhunderten kunstvoll in Stein gehauen, standen diese Skulpturen
überall in der Steppe - sie sollten die bösen Geister milde stimmen.
Foto: Detlev Steinberg
"Die sibirischen Völker können nicht ohne Schamanen leben. Zum Pfarrer kann man ausgebildet werden, als Schamane wird man geboren."
Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014
Ereignisse nach dem Zerfall der Sowjetunion, sofern sie nicht bereits oben aufgeführt sind: Es kam zu Ausschreitungen der Einheimischen gegenüber dn Russen, z. B. 1990 in der Bergarbeitersiedlung von Chowu-Aksu. Das war verbunden mit einer massenhaften Auswanderung der Russen. Heute werden die Spannungen vor allem auf politischer Ebene ausgetragen. Dennoch nimmt die Zahl der Russen in den Städten rapide ab - in Turan um 10 Prozent, in Schagonar um 11 Prozent, in Tschadan um 13 Prozent. Damit verlassen viele Angehörige der wissenchaftlich-technischen Intelligenz Tuwinien. - Seit März 1992 ist Tuwinien eine selbständige Republik im Verband der Russischen Föderation und verfügt über ein eigenes Staatswappen und eine eigene Flagge: fünf Erdteile, ein der Sonne entgegengaloppierender Reiter und der weiße Seidenschal "Chadak", Gastfreundschaft und die Zugehörigkeit zum Buddhismus symbolisierend; die Flagge wurde 1993 beim Besuch des Dalai-Lama in Tuwa geweiht. - Am 31. März 1992 war Tuwa einer der Unterzeicher-Länder des Vertrags zur Schaffung der Russischen Föderation. Immer wieder wird die Frage nach völliger Souveränität Tuwas gestellt, mit völliger Unabhängigkeit von Russland. Die Anhänger dieser Idee konnten bei einer Tagung des Obersten Churals 1992 immerhin 10 Prozent der Stimmen erhalten. Auch gibt es im Lande Kräfte, die das Land an der Seite der Mongolei sehen wollen. Außerdem hat China seine Rechte auf das Teritorium Tuwas nie aufgegeben. - Seit 1992 sind ein Drittel der Betriebe Tuwas bankrott. Das Ergebnis: Zunahme der Arbeitslosigkeit (über eine Million Menschen), der Kriminalität, der Drogensucht (man schätzt die Größe der Hanffelder auf über 22 000 Hektar) der Obdachlosigkeit; es fehlen Lehrstellen für 40 Prozent der Schulabgänger. - 2004 forderte die Senatorin der Republik, Ljudmila Narussowa den Hanfanbau in Tuwinien zu legalisieren. Das Problem der Drogensucht könne gelöst werden ohne die Hanffelder - die Lebensgrundlage vieler tuwinischer Familien - zu zerstören. Aus Hanf, so regte sie an, könnten Pharmazeutika hergestellt werden, die in Länder exportiert werden könnten, in denen der Gebrauch der Drogen legal sei.
„Die meisten Tuwiner rauchen keinen Hanf, nur die 120jährigen Frauen kann man pfeiferauchend im Sonnenuntergang vor den Jurten sitzen sehen. Eigentlich ist das verboten.“
Der Tagesspiegel vom 8. Oktober 2003
- Am 17. August 2009 kam es beim Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskoje zu einem schweren Unglück, das 75 Menschenleben kostete. Der Schaden war enorm, an der Bewältigung der Katastrophenfolgen nahmen zweitausend Menschen teil. Die Gefahr einer Überflutung von stromabwärts gelegenen Siedlungen bestand nach Angaben des russischen Zivilschutzministers Sergej Schoigu - geboren in Tuwinien - nicht. Gegen einen Journalisten des Internet-Journals „Nowy Fokus“, der am 18. August 2009 über im Maschinenhaus Eingeschlossene berichtete, wurde am 19. August 2009 ein Strafverfahren wegen Verleumdung eingeleitet; am 9. September 2009 wurde er von zwei Unbekannten zusammengeschlagen. - Gegenwärtig wird über eine frühere Rente für Kehlkopf-Sänger nachgedacht. - Das Gebiet um die Buntmetalllagerstätte Kara-Sug ist strahlungsgefährdete Zone; das Strahlungsniveau überschreitet stellenweise 2 000 Mikroröntgen pro Stunde. Außerdem liegt die Tuwinische Republik im Radius des ehemaligen sowjetischen Atomwaffengeländes von Semipalatinsk.
Kontakte zu Deutschland: Tuwa war eines der ersten Länder, das am 22. Juni 1941 auf den Angriff Hitlers auf Russland mit einer Kriegserklärung reagierte." - 2001 hat ein deutsch-russisches Archäologenteam in Tuwinien einen Sensationsfund gemacht, der von seiner Bedeutung mit dem Grabfund Tutanchamuns in Ägypten verglichen wird: ein skythisches Fürstengrab mit über 6000 Schmuckstücken aus Gold. Nachdem ein Teil davon in Ausstellungen als "Das Gold von Tuwa" um die Welt ging, wird der Schatz des sogenannten Arschan II jetzt im Nationalmuseum in Kysyl von uniformierten Bodyguards bewacht. - Präsident der Republik Tuwa ist Scholban Kara-ool. Er hat Philosophie, Politologie und Soziologie an der Staatlichen Universität in Swerdlowsk studiert und --- beherrscht die deutsche Sprache.
Interessant, zu wissen..., dass ausgerechnet ein tuwinischer Fisch beweisen soll, was für ein toller Hecht Wladimir Putin ist.
Der russische Präsident wurde kürzlich mit einem angeblich 21 Kilogramm schweren Hecht – den der Deutsche Anglerverein auf 10 Kilo herunterstufte - aus dem See Tokpak-Hol im südsibirischen TUWINIEN abgebildet. Der russische Abenteuer-Präsident und angeblich begnadete Angler teilte seinem staunenden Volke mit, dass der Fisch über einen Meter lang sei. Der Kreml zeigt regelmäßig, wie der Staatschef als harter Mann in der Natur unterwegs ist und dabei Kranichen, Eisbären und sibirischen Tigern gefährlich nahe kommt. Eine besonders spektakuläre Expedition lieferte einst Bilder von Putin, wie er im Pazifik mit einer Harpune Wale jagte. Dumm nur, dass diesmal aufmerksame Russen bemerkten, dass Putin eine Hose trug, die er schon vor Jahren getragen und eine Uhr, die er lange vor seinem Anglerglück einem tuwinischen Hirten geschenkt hatte...
Was dem Vogel sein Nest ist dem Menschen die Heimat.
Sprichwort der Tuwiner
Die TUWINER: Für Liebhaber kurzer Texte
Das Land der Tuwiner galt wegen der hohen Gebirgsketten des Sajan bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein als eines der am schwersten zugänglichen Gebiete Asiens. Douglas Carruthers, ein reicher englischer Globetrotter mit Forscherambitionen, war einer der wenigen, die Tuwinien damals bereisten. Als erster bestimmte er Tuwinien geodätisch und mathematisch als "das Herz Asiens". Von hier aus ist es gleich weit bis zum Bosporus oder bis zur Beringstraße, bis zum Kap Tscheljuskin oder bis nach Singapur. - Die Tuwiner sind aus einer Vermischung turksprachiger Stämme mit Keten, Samojeden und Mongolen hervorgegangen, das Tuwinische gehört zur uigurischen Gruppe der östlichen Turksprachen. Seit dem 7. Jahrhundert standen die am oberen Jenissej und seinen Zuflüssen lebenden Tuwiner unter der Herrschaft der Chinesen. Diesen folgten als Eroberer die Uiguren und Jenissej-Kirgisen. Vom 13. bis 17. Jahrhundert gehörten die Gebiete der Tuwiner zum Machtbereich mongolischer Herrscher, die von den Kalmyken verdrängt wurden. Das expandierende Mandschu-Reich brachte schließlich die Tuwiner in der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder unter chinesische Herrschaft. Die ersten Kontakte zwischen Tuwinern und Russen kamen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zustande, als die Chinesen dem Russischen Reich 1860 Handelsrechte eingeräumt hatten. Damals nannte man dieses Gebiet Tuwa oder Urjanchai. Die Tuwiner waren lamaistische Buddhisten, einige der fast hundertsiebzigtausend Tuwiner sind es wohl auch heute noch. - Die Viehzüchter unter den Tuwinern leben noch größtenteils in Jurten, einer transportablen zeltartigen, runden Behausung. Erhalten hat sich bei ihnen - und bei den Chakassen, den Ostaltaiern, Baschkiren und Nordmongolen - auch der Chöömej. Bei diesem Kehlkopf- oder Zweilautgesang singt ein einziger Mensch so, als ob zwei Sänger zweistimmig am Werke wären. Bald glaubt man, einen Dudelsack zu hören, bald ein Waldhorn, bald eine Maultrommel, bald eine Querrohrflöte. Erhalten hat sich bis auf den heutigen Tag auch die tuwinische Nationaltracht, die nicht in der Truhe liegt, sondern täglich getragen wird: der Tonn, das mantelartige, wadenlange, mit Fell gefütterte Obergewand für den Winter, und der lilafarbene, giftgrüne, mohnrote... Deel, die Sommerkleidung, im Schnitt ähnlich, nur ungefüttert.
Diesen bisher unveröffentlichten Text habe ich geschrieben, als ich für das Bibliographische Institut in Leipzig von 1986 bis 1991 ein Sprichwörterbuch von fünfzig Völkern der (ehemaligen) Sowjetunion erarbeitete, das wegen des Zerfalls der Sowjetunion nicht mehr erschienen ist.
Als Journalistin der Illustrierten FREIE WELT – die als Russistin ihre Diplomarbeit über russische Sprichwörter geschrieben hat - habe ich auf allen meinen Reportagereisen in die Sowjetunion jahrzehntelang auch Sprichwörter der dort ansässigen Völker gesammelt - von den Völkern selbst, von einschlägigen Wissenschaftlern und Ethnographen, aus Büchern ... - bei einem vierwöchigen Aufenthalt in Moskau saß ich Tag für Tag in der Leninbibliothek. So ist von mir erschienen:
* Aus Tränen baut man keinen Turm, ein kaukasischer Spruchbeutel, Weisheiten der Adygen, Dagestaner und Osseten, Eulenspiegel Verlag Berlin in zwei Auflagen (1983 und 1985), von mir übersetzt und herausgegeben, illustriert von Wolfgang Würfel.
* Dein Freund ist dein Spiegel, ein Sprichwörter-Büchlein mit 111 Sprichwörtern der Adygen, Dagestaner Kalmyken, Karakalpaken, Karelier, Osseten, Tschuktschen und Tuwiner, von mir gesammelt und zusammengestellt, mit einer Vorbemerkung und ethnographischen Zwischentexten versehen, die Illustrationen stammen von Karl Fischer, die Gestaltung von Horst Wustrau, Herausgeber ist die Redaktion FREIE WELT, Berlin 1986.
* Liebe auf Russisch, ein in Leder gebundenes Mini-Bändchen im Schuber mit Sprichwörtern zum Thema „Liebe“, Buchverlag Der Morgen, Berlin 1990, von mir (nach einer Interlinearübersetzung von Gertraud Ettrich) in Sprichwortform gebracht, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen, illustriert von Annette Fritzsch.
Ich bin, wie man sieht, gut damit gefahren, es mit diesem turkmenischen Sprichwort zu halten: Hast du Verstand, folge ihm; hast du keinen, gibt`s ja noch die Sprichwörter.
Hier fünfzig tuwinische SprichwörteR:
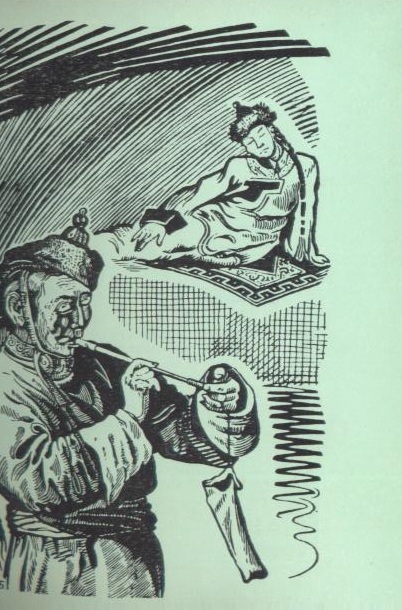
Illustration zu den tuwinischen Sprichwörtern.
Zeichnung von I. J. Kusnezow aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
(Bisher Unveröffentlicht)
Je fleißiger du bei der Arbeit bist, mit umso mehr Appetit du isst.
Nicht jedes Auge kann Schönheit schauen, nicht jede Hand welche erbauen.
Disteln dem Kameltier munden - wie muss sich da die Ziege wundern.
Die Ziege klettert den Felsen hinauf - da reißt das Kamel die Augen auf.
Herumsitzen - kein Erfolgt, herumliegen - kein Stück vom Glück.
Keine Fäustlinge - die Finger steif und starr. Keine Schwiegertochter - wer
macht das Essen warm?
Elstern, die sich einig sind, selbst ein Kamelhengst nicht entrinnt.
Die Fernen wissen´s vom Hörensagen, den Nahen wird´s zugetragen.
Wen du einmal lobst, der setzt sich zu dir ans Feuer, doch bedenke: übertrieben
Lob stellt sich teuer.
Bist du reich geworden, brüste dich nicht; ist dein freund arm geblieben, bewirte ihn schlicht.
Keine Freunde findet der Grobian, keine Ruhe - der Liederjan.
Lässt du einen Funken fallen - ein Brand ist entflammt; lässt du eine Bemerkung fallen - ein
Gerücht ist entbrannt.
Rot im Gesicht - das Schuhzeug drückt. Schultern gebückt - Ehe ohne Glück.
Ein schlechtes Gewehr verfehlt das Ziel, ein Kind ohne Gehorsam bringt der Sorgen viel.
Willst du in ein Haus eintreten, beuge dein Hupt nie; willst du aus einer Quelle trinken,
geh getrost in die Knie.
Hochwasser unterspült auch ein befestigtes Ufer, üble Nachrede verdammt eine
Braut zur Jungfer.
Mit den Hörnern stößt der dümmste Stier am meisten. Wer nicht überzeugen kann,
droht mit den Fäusten.
Wenn ein Hund beißt, fließt Blut; beißt ein Gerücht, fließen Tränen in Strömen.
Sitz in der Jurte nicht tatenlos, tu dich vor den Leuten im Streit nicht groß.
Wenn vor Hunger knurrt der Bauch, kommt schlechte Laune auf.
Einen Knochen kann man nicht zweimal abnagen, den Freund darf man sich
nicht zweimal versagen.
Verbeiß dich nicht in einen Knochen, wenn du arm bist; wirf nicht mit Fleisch, wenn du reich wirst.
Nichts fester als ein doppelter knoten ist, nichts tiefer als das Feindschaft kann entstehen
durch spöttisches Lachen.
Wer Kühe hat, wird satt: wer Schafe hat, wird fein gekleidet sein.
Bist du allein - denke dir, was du willst ein einem fort, vor den Leuten bedenke jedes Wort.
Ein stumpfes Messer ist kein Messer, ein plumpes Wort ist auch nicht besser.
Ein Pfau entzückt sich an seinem Rad, ein Vater am Kind Entzücken hat.
Ein gefiederter Pfeil bleibt ohne Beute, unbekümmerter Leichtsinn schon manchen gereute.
Mein Pferd, und mag´s mager sein! Der Sattel schäbig - aber mein,
Den Räuber bringen schlaflose Hunde in Brast, der Märchenerzähler schläfrige Menschen hasst.
Ein dickes Scheit erdrückt das Feuer, die Unordnung der Hausfrau stellt sich teuer.
Willst du ein Pferd prüfen - reite kreuz und quer, willst du deine Verwandtschaft
erkennen - reite mit ihnen zusammen einher.
Mit Schönheit lässt sich kein Tee aufbrühen, mit einem Zopf kein Reitpferd ziehen.
Repariere lieber deine Schuhe, die Angelegenheiten anderer lass in Ruhe.
Der Schwur schärfer als ein Messer ist. Das Gerücht schneller als ein Hase flitzt.
Ein spitzer Splitter gelangt schnell in die hand, eifersüchtige Augen sehen stets über den Rand.
Wohin der Stein geworfen wird, dort bleibt er liegen; wohin man die Tochter gegeben,
dort muss sie leben.
Es will gekonnt sein, einen Strick zu drehen, und auch - ein Sprichwort zu verstehen.
Prahl nur mit dem, was du fängst. aus einer Stute wird kein Hengst.
Mit dem Tee für den Gast hat´s noch Zeit, die Pfeife aber halte griffbereit.
Bittet die Tochter - sollst du Nagel und Faden geben; bittet der Sohn - muss er
nach Messer und Feuer streben.
Die Tochter wächst bei der Mutter zur Jungfrau heran, der Sohn wird beim Vater zum Mann.
Vögel sitzen in einem verzweigten Baum, Menschen in der Jurte Raum.
Am Vogelknochen suche kein Fett, beim Obdachlosen kein Bett.
Wenn das Wasser bis zur Schnauze reicht, schwimmt auch ein kleines Kälbchen leicht.
Kaltes Wasser härtet Stahl, den Menschen stählen Not und Qual.
Ein gutes Wort tausche auch nicht gegen viel Fleisch, ein Geheimnis gibt für Speck nicht preis.
Der Blitz verursacht Brand im Ort. Der Krieg rafft Menschenleben fort.
Mach einen Falken nie im Fluge scheu. Erhebe nie unnötiges Geschrei.
Festgewalkter Filz hält stand bei Wind und Wetter. Feste Eintracht kann vor jeder Not erretten.
Der Himmel klart auf, auch nach mächtigem Sturm. Ein schlechter Charakter
ist beständig wie ein Turm.
Aus dem Russischen übersetzt und - wie die Originale - gereimt von Johann Warkentin; gesammelt und in Sprichwortform gebracht von Gisela Reller
Zitate: "Ich war der erste Nichtrusse, der die Republik Tuwa betrat. (...) Die `Philosophie´ der Tuwiner zerlegt den Menschen in mehrere Wesenheiten. Den Körper, `Fleisch, Knochen und Blut´, belebt das Tyn. Tyn haben alle Lebewesen, Menschen, Tiere und Pflanzen. Durch das Tyn leben sie, atmen und wachsen sie. Man darf Tyn mit Leben oder Lebenskraft übersetzen. Außer dem Tyn haben Menschen und Tiere noch eine Seele, Sünä, die sich schon zu Lebzeiten des Menschen, wenigstens für einige Zeit, vom Körper trennen kann. Manche Leute haben die Gabe, schweifende Sünä zu sehen; Schamanen und die tuwinischen Spökenkieker sehen sie manchmal in Menschengestalt. Auch Hunde können sie erblicken. Wenn ein Hund grundlos bellt, dann weiß man, daß er eine Seele gesehen hat. Ein Mensch, dessen Seele gesehen wird, stirbt bald."
Otto Mänchen-Helfen in: Reise ins asiatische Tuwa, 1931
*
„Tannu Tuwa ist hermetisch verriegelt. Rotarmisten sperren die wenigen Bergpässe, die über das Sajanische und das Tana-Gebirge in die riesige Tallandschaft führen. Nur Flugzeuge mit Hochdruckkabinen können die Felswände überfliegen. Jeder Zugang nach Tuwa ist ein Thermopylae [eine antike Ortsbezeichnung]. - Für die Sowjets ist dieser jahrzehntelange Vorposten Rußlands im Kampf um Asien heute `tabu´. Die Zeitungen, angefüllt mit Berichten aus den entlegensten Winkeln der Union, scheinen seinen Namen nicht mehr zu kennen.
Seit Hiroshima wird er mit Methode totgeschwiegen.“
"Der Spiegel" vom 8. Oktober 1948
*
"Ich war damals noch zu klein, um darüber nachzudenken, weshalb unter diesem hellen, glücklichen Himmel unser Leben so bitter und hoffnungslos war und weshalb es in unserem Birkenrindentschum so bettelarm zuging. (...) Zu dieser Zeit hatte sich an der Tersigmündung russische Bauern niedergelassen, fünf oder sechs Häuser standen dort. Wie gern hätte ich diese Holztschums einmal von innen gesehen und erfahren, wie die mir unbekannten Menschen darin lebten."
Saltschak Toka in: Das Wort des Arat, 1951
*
"Offiziell galten die Tuwiner als Lamaisten. Doch obwohl der Lamaismus seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts
in Tuwa verbreitet war, blieb der Schamanenkult bei den Tuwinern bis ins 10. Jahrhundert hinein lebendig. Es ist interessant, daß noch im Jahre 1931 mehr als 700 praktizierende Schamanen in Tuwa
registriert werden konnten."
Sewjan Wainschtein 1963 in: Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig,
Band XXIX, 1973.
*
"Der Schamanismus! War das jemals eine Religion? War es nicht vielmehr Lebensform naturverbundener und naturgläubiger Völker, war es nicht Medizin und Heil- und Tanzkunst, Verehrung der Ahnen, sorgfältiges Beobachten und Interpretieren von Natur und Umwelt, bunt verkleidet und angemessen dem Bildungsstand des Volkes? Schamanen waren keine Priesterkaste und keine Fürstenkinder, Schamanen kamen aus dem Volk; jeder konnte das werden, ob Mann oder Frau, sie hatten Gaben und Fähigkeiten, die anderen verschlossen waren - das war ihr einziges Privileg. Niemals hat eine der großen Religionen, weder der aufgezwungene Buddhismus noch das mit den russischen Kolonisten importierte Christentum, den Schamanismus verdrängen können, und noch heute, sagt der Professor, gebe es Reste davon in den entlegenen Teilen Tuwas."
Egon Richter in: Im Land der weißen Kamele, 1986
*
„In Tuwa sind archäologische Funde keine Seltenheit. Allein in der Ebene bei Arschan liegen Hunderte Hügelgräber, die meisten unerforscht. Die Steppe ist geradezu gespickt mit Steinstelen, die wie vergessene Bauklötze aus dem Boden ragen. In der Religion der Tuwa haben sie alle eine Seele. Die Einheimischen glauben, wenn man einen Stein bewegt, weint er drei Tage lang.
„Der Spiegel“ vom 23. August 2010
Als Reporterin der der Illustrierten FREIE WELT bereiste ich 1983 Tuwinien. In meinem Buch "Von der Wolga bis zum Pazifik", 236 Seiten, mit zahlreichen Fotos von Detlev Steinberg und ethnographischen Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring, 1990 im Verlag der Nation, Berlin, erschienen, habe ich über die TUWINER, Kalmyken, Niwchen, Oroken und Tofalaren geschrieben.
Ankunft in Kysyl (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
„Das Land der Tuwiner galt wegen der hohen Berge des Sajan bis in die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein als eines der am schwersten zugänglichen Gebiete Asiens. Sprichwörtlich sagte man, auf das `Dach der Welt´ anspielend: `Eher gelangst du nach Tibet als nach Tuwa.´
Mrs. French, eine Irländerin, hatte 1924 versucht, in die seit drei Jahren bestehende Volksrepublik Tannu-Tuwa zu gelangen. Der deutsche Ethnograph Otto Mänchen-Helfen schrieb darüber in seinem 1931 in Berlin erschienenen Bericht `Reise ins asiatische Tuwa´: `Sie kam im Auftrag eines amerikanischen Zeitungskonzerns in einem wunderbar ausgestatteten Automobil, mit Kinoapparat, Revolver und Worcestersauce, von Ulan-Bator, der mongolischen Hauptstadt, quer durch die Wüste Gobi. An der Grenze wurde sie angehalten und ebenso höflich wie entschieden zurückgeschickt.´
Fünf Jahre später jedoch gelang es Otto Mänchen-Helfen selbst, in das `für Europäer verschlossene Land Asiens´ einzureisen - als Völkerkundler, `bekanntlich politisch harmlos wie Pilzkenner und Briefmarkensammler´. Seit 1927 arbeitete er in Moskau als Leiter der Soziologisch-Ethnologischen Abteilung des Marx-Engels-Instituts, sein Ziel war, `den Schamanismus, die alte Religion der Völker Nord- und Innerasiens, an Ort und Stelle zu studieren´. Endlich, nach tausend Stellen und Ämtern und unzähligen auszufüllenden Fragebogen `was haben Sie im Jahre 1917 gemacht und warum?´, durfte der Bürger Otto (der Familienname wurde offensichtlich als solcher nicht erkannt) in die Volksrepublik Tannu-Tuwa `wallfahren´- zusammen mit fünf in Moskau studierenden Tuwinern, die `Schamanisten zu Atheisten, Anbeter Buddhas zu Anbetern des Traktors machen sollten´.
Heute ist es nicht schwer, als dienstreisender Ausländer, nach Tuwinien zu kommen - wenn das Wetter ein Einsehen hat. Dann nämlich besteigt man in Moskau ein Flugzeug und reist in etwa fünf Stunden entweder geradewegs nach Tuwiniens Hauptstadt Kysyl, oder - nicht täglich fliegt eine Maschine direkt bis Kysyl - man macht nach etwa vier Stunden Zwischenstation in Abakan, der Hauptstadt des Chakassischen Autonomen Gebiets. Von hier aus ist der Flugverkehr nahezu so wie anderswo der Busverkehr; in Abakan ist Endstation der Eisenbahn, nach Tuwinien führt noch kein Schienenstrang.
"Tuwa ist vielleicht das gottverlassenste Fleckchen auf der Welt, ganz sicher aber auf dem asiatischen Kontinent (...).
Jacek Hugo-Bader (polnischer Buchautor) in: Ins eisige Herz Sibiriens, Eine Reise von Moskau nach Wladiwostok, 2014
Von Abakan bis Kysyl hat man vierzig Flugminuten lang die Wolken unter sich und Muße, die Physiognomie der tuwinischen Fluggäste zu studieren. Sie haben breite Gesichter, hohe Backenknochen, asiatisch schmale Augen, immer tiefbraun; die Haare sind schwarz, ein wenig störrisch; Männer und Frauen sind von kleinem bis mittelgroßem Wuchs. Und ich bilde mir ein, einen Städter von einem Landbewohner unterscheiden zu können, nicht an der Kleidung, nein, allein nach dem Aussehen der Haut. Ist sie hart und faltig wie Leder, so sehe ich ihren Besitzer bei sengender Hitze inmitten der Steppe Schafe hüten. Oder auf einsamen Gebirgsweiden unterwegs mit einer Herde Kamele. Oder bei beißender Kälte als Gebieter über Yaks und Rentiere.
Schon aus der Luft bekommt man einen ersten Eindruck von dem Land: Man erblickt - wenn das Flugzeug mehr und mehr an Höhe verliert - den majestätischen Jenissej, erspäht die Berge des Sajan, schneebedeckt die höchsten, und Steppe, Steppe mit vielen kleinen, sich bewegenden Pünktchen: wohl Schafe, Ziegen, Pferde.
Kaum sind wir gelandet, empfängt uns eine Frau: Marina Smirnowa. Trotz ihres russischen Namens eine Tuwinerin, das sieht man auf den ersten Blick. Sie stellt sich als Mitarbeiterin des Gebietsparteikomitees der Tuwinischen ASSR vor und wird für die nächsten Tage unsere ständige Begleiterin sein.
Fünf Hotels hat Kysyl. Wir - so sagt sie - seien im Gästehaus des Gebietsparteikomitees untergebracht, weil man dort die schönste Aussicht habe. Die Zimmer allerdings, die seien in den Hotels schöner. Ob sie da wohl richtig entschieden habe, fragt sie mich. Ich nicke.
Heute, meint Marina Smirnowa, sollten wir erst einmal auspacken und ein wenig ausspannen; morgen beginn dann das Programm.
Von meinem Zimmer aus blicke ich auf ein ländliches Holzhaus. Auf dem Dach aalt sich eine Katze. (Bald schon wird sie auf den Namen meiner Katze Minka hören.) Das Haus steht direkt am Fluss. Und dieser Fluss ist der vielbesungene, vielbeschriebene Jenissej. Nur wenige Schritte von hier fließen der Kleine Jenissej. die Tuwiner nennen ihn Kaa-chem, Kleiner Fluss, und der Große Jenissej, von den Tuwinern Bij-chem genannt, zusammen, hier nimmt der eigentliche Jenissej seinen Lauf. Am gegenüberliegenden Ufer dehnt sich ein breiter Steppenstreifen, dahinter, verhangen durch zarte Nebelschleier, das Sajangebirge, terrassenförmig ansteigend in der Ferne mit weißen Gipfeln. Um diesen erhaben-schönen Anblick zu beleben, kommt gerade rechtzeitig ein Reiter ins Bild; gemächlich trabt er dahin auf seinem geschmeidigen braunen Pferd. Er ist ganz in Lila gekleidet, ob schon im Tonn - dem mantelartigen, wadenlangen, mit Fell gefütterten Obergewand für die kalte Jahreszeit, rechtsseitig zu schließen, in der Taille durch einen sehr langen Gürtel gehalten - oder noch im Deel - der Sommerkleidung, ähnlich im Schnitt, nur ungefüttert -, das kann ich von meinem Balkon aus nicht erkennen.
Wie immer auf Reisen packe ich nicht gleich aus, sondern mache mich sofort auf den Weg durch den fremden Ort, um mich erst einmal ohne Stadtführer umzusehen.
Den beschriebenen beruhigend-malerischen Ausblick hat man nur von den nach hinten hinaus liegenden Zimmern des Gästehauses. Geht man vorne hinaus, ist man sogleich inmitten einer Leben sprühenden Stadt mit meist fünfstöckigen Häusern und pulsierendem Verkehr. Beim ersten Spaziergang durch Kysyl fesselt vor allem das Theater mit seinen fremdartigen Holzornamenten meinen Blick, und mit Vergnügen schaue ich im liebevoll angelegten Kinderpark den Kleinen zu, wie sie auf den Großen - kunstvoll geschnitzten mannshohen Holzplastiken - respektlos herumtollen.
Auf dem Weg zurück ins Gästehaus biege ich nach rechts ab und bin, quer durch den Stadtpark gehend, unvermittelt wieder am Jennissej. Dem Fahrplan einer Anlegestelle ist zu entnehmen, dass hier bis zum Winter regelmäßig Schiffe verkehren. Viele Orte sind mit dem Auto unerreichbar, denn Tuwinien hat erst zwei asphaltierte Straßen: die eine führt von Kysyl nach Abakan, die andere von Ak-Dowurak nach Abasa.
Ein paar hundert Meter weiter, einen schmalen Pfad den Fluss entlang, steht ein Obelisk, der in russischer, tuwinischer und englischer Sprache verkündet, dass sich hier, genau hier, das Zentrum Asiens befindet. In englischer Sprache deshalb, weil Douglas Carruther, ein englischer Globetrotter mit Forscherambitionen, diesen Ort 1910 als erster geodätisch und mathematisch als das `Herz Asiens´ bestimmte.

Ein Obelisk in Kysyl, der verkündet, dass sich hier, genau hier, der Mittelpunkt Asiens
befindet - was Gisela Reller, Nina Charitonowa und Detlev Steinberg beeindruckt zur Kenntnis nehmen....
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
Douglas Carruther ist einer der ganz wenigen, die Tuwa schon damals bereisten. Mänchen-Helfen beschreibt ihn als `spleenigen Engländer von der Art jener, die Jules Verne als Helden liebt´.
Carruther jagte damals durch die Welt zu dem einzigen Zweck, im Mittelpunkt eines jeden Erdteils einen Gedenkstein zu errichten. Afrika, Nord- und Südamerika hatten schon ihre Steine, als er auszog, dem Herzen Asiens ein Denkmal zu setzen. Nach seiner Berechnung lag es an den Ufern des oberen Jenissej. Als reicher Sportsmann, `zäh wie so viele Narren´, ließ er sich durch keine Schwierigkeit abschrecken. Er erreichte sein Ziel - für viel klingende Münze erlaubten ihm die mandschurisch-chinesischen Herrscher, das Denkmal zu errichten.
Nach seinem Aufenthalt in Tuwa schrieb Carruther, das die tuwinischen Araten (Viehzüchter) auf dem sicheren Weg des schrittweisen Erlöschens´ seien.

Meine Hotel-Aussicht mit dem "ländlichen Holzhaus", über die ich ich im vorangegangenen Kapitel schreibe, hat mir Lisa Klutschewskaja, Malerin und langjährige
Moskau-Korrespondentin der FREIEN WELT - nachdem mein Tuwinien-Beitrag in der FREIEN WELT Nr. 15/1984 erschienen war - freundschaftlich zur Verfügung gestellt.
Ich veröffentlichte es mit einem umfänglichen Text in der FREIEN WELT 1/1985. Leider - das Kätzchen Minka ist gerade abwesend gewesen...
Zeichnung aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
Wie die Tiere des Waldes (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Vor mehr als zwanzig Jahren las ich die Erzählung `Das Wort des Arat´ von Saltschak Toka, dem Begründer der tuwinischen Literatur. Was er über die letzten Jahre der Oktoberrevolution und die Zeit während der Revolution schreibt, hat mich so beeindruckt, dass ich mich sogleich an dieses Buch erinnere, als unsere Reise in die Tuwinische ASSR geplant wird. Saltschak Toka (1901 bis 1973) beschreibt Armut und Hoffnungslosigkeit seiner Kindheit und Jugend, es ist die Zeit da Douglas Carruther den tuwinischen Araten ihr Aussterben prophezeite.
Aus Saltschak Tokas Erzählung in der Übersetzung von G. Tanewa:
`Fünf Kinder hatte meine Mutter: die Schwestern Albantschi und Kangy, die Brüder Schumuktai, Peshendai und mich, den Jüngsten. An den Vater kann ich mich nicht erinnern. Einen richtigen Namen hatte meine Mutter nicht. Die Leute nannten sie Tas Baschtyg, die Kahlköpfige.
Die Mutter war nicht schön, sie war klein und krumm. Eines Tages rief sie uns und erklärte, dass wir nun an einen anderen Ort ziehen würden. Zu sechst, eine nicht allzu schwere Last auf dem Rücken, erreichten wir die neue Heimat am Mergen. Die Mutter borgte sich von einem Holzfäller ein Beil und baute an der schönsten Stelle des Ufers, dort, wo die Vorberge endeten, einen kleinen Tschum, ein mit Birkenrinde bedecktes Stangenzelt. Als Lagerstatt für die Familie häufte sie darin Fichtenzweige und dürre Gras. Dann brachte sie trockenen Mist und streute ihn darüber, damit man weicher und wärmer schlafe. Die kleinen Stämme, das Gerippe der Hütte, waren oben zusammengebunden und von außen mir Birkenrinde belegt. Wenn es regnete, sickerte Wasser durch, im Winter drangen Wind und Kälte ein. Wir lebten im Tschum wie die Tiere des Waldes...
Wir hatten viele Nachbarn, doch sie waren ebenso arm wie wir und wohnten in ebensolchen Tschums. Gegen Ende des Winters vermieden wir es, einander anzusehen, so schrecklich war unser Anblick. Bei meinem älteren Bruder Peshendei drohten die Backenknochen die Haut zu sprengen, all seine Rippen waren zu sehen...
Als wir zur Tersingmündung gezogen waren, suchte uns als erster Gast Danila Potylitzyn auf, ein älterer, gebückt gehender Junggeselle. Er war einer der russischen Siedler vom Kaa-chem. Anfangs fürchteten wir uns vor ihm. Wenn er sich unserem Tschum näherte und Mutter und Albantschi nicht da waren, rissen wir in den Wald aus. Doch Danila kam immer öfter... Danila und Albantschi wurden Mann und Frau, doch nicht für lange; denn Danila ging im Herbst mit den Goldsuchern in die Taiga und kam bei Erdarbeiten um. Albantschi brachte eine Tochter zur Welt. Sie bekam den Namen Sürünma. Eines Nachts wurde ich wach und hörte, dass Sürünma kläglich weinte. Ich kroch unter die Lumpen, die als Decke dienten, und beobachtete heimlich die Mutter. Sie goss den Rest des Tees, der schon mit einer dünnen Eiskruste bedeckt war, aus der gusseisernen Schale in den Holzeiner und steckte Sürünmas Händchen hinein. Am nächsten Morgen knurrte sie: `Ich habe sie doch fest eingewickelt. Wie hat sie es bloß fertiggebracht, die Hände rauszustrecken? Um ein Haar wären die Hände weggewesen.´ Sie wandte sich an mich. `Wenn wir nicht vor Tag aufgestanden wären, wären ihr die Hände oder die Finger erfroren...´´
Inzwischen ist Saltschak zehn Jahre alt, die Familie wird immer kleiner, denn nacheinander gehen Schwestern und Brüder weg, um bei Fremden zu arbeiten.
`Um Peshendai und Kangy öfter besuchen zu können, entschlossen wir uns, in ihre Nähe zu ziehen. ich glaube, die Mutter hatte auch noch einen anderen Grund: Sie wollte gern dem Leben und der Arbeit der russischen Bauern zusehen... Hier gab es große Öfen aus Lehm, in denen aus gemahlenen Körnern eine runde Speise mit bräunlicher Kruste gleich für mehrere Tage im voraus gebacken wurde: Brot.´
Saltschak gewinnt in dem gleichaltrigen Russen Wanja einen richtigen Freund. Allerdings haben die beiden einiges miteinander durchzustehen. So, als Wanja seinen neuen Freund Saltschak mit ins Badehaus nimmt. Wie böse ist Saltschak, als Wanja ihm seinen Zopf abschneidet, weil sich darunter ein `richtiger Ameisenhaufen´ befindet. Oder als er ihm etwas in die Hand drückt, das wie Pyschtak (Hirschkäse) aussieht.
`Wanja rieb seinen Kopf mit dem kleinen Stück Hirschkäse ein und hatte plötzlich eine hohe weiße Mütze auf. Ich beeilte mich, ihm nachzueifern. Das war sie also, die Seife, braun mit weißem Schaum. So klein und setzte zwei Köpfen eine Mütze auf! Aber meine Fröhlichkeit fand sofort ihr Ende, als ich spürte, dass meine Augen voll von fressendem Gift waren. Ich würde sie nie mehr öffnen können...´
Doch nachdem Wanja ihn abgespült hat, schmerzten die Augen nicht mehr, und `sein Kopf, sein ganzer Körper waren leicht wie nie zuvor´. An jenem Tag war er ganz aufgeregt, als er sich dem Tschum näherte. Was würde die Mutter zum Verschwinden seines Zopfes sagen? `Die Mutter hörte sich meinen Bericht an an und hieß das Geschehene gut.´
Als Saltschak Toka elf Jahre alt war, und `also schon ein Mann´, verdingt die Mutter ihn bei der russischen Siedlerfamilie Lubaschnikow. Sie hatte sich vor den Saratower Kulaken und Gutsbesitzern hierher gerettet. In den Jahren, die Saltschak als Knecht verbrachte, erlebte er `viel und wurde größer und stärker...´ Oft kamen bewaffnete Menschen, `von den einen sagt man, es seien Weiße, von den anderen, es seien Rote, und den dritten, es seien Mongolen´. Und eines Tages umarmte ihn die Mutter und meinte: `Jetzt wird alles gut werden. Die armen Araten begrüßen die neuen Menschen, die nach Tannu-Tuwa gekommen sind, mit Freuden. Sogar die Taiga verneigt ich vor ihnen.´"
Hammel tuwinisch (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"An unserem ersten Abend im Tuwinerland sitzen wir noch lange mit Marina Smirnowa zusammen, die darauf bestand, bei unserer Premierenmahlzeit auf tuwinischem Boden dabei zu sein. Mir schmeckt von allen Gängen des umfangreichen Essens am besten Tyrtkan, hier das Rezept:
Man nehme Hammelfleisch, drehe es zweimal durch den Wolf, schmecke es mit Salz und Pfeffer ab und tue viel klein gehackte Zwiebeln dazu (etwa zwei Drittel Fleisch, ein Drittel Zwiebeln). Das ganze verdünne man mit Milch, diese Masse gebe man in eine feuerfeste Schale, in Tuwinien ist e stets eine Porzellanschale. Dann bereite man aus Roggenmehl einen dicken Teig, sozusagen als Deckel für das Porzellantöpfchen, und nun etwa fünfundvierzig Minuten ab damit in die Backröhre. Was danach zum Vorschein kommt, ist obenauf knusprig Gebackenes, das man wie Brot zu dm nunmehr in köstlicher Brühe schwimmenden, sehr herzhaft schmeckenden Fleisch dazu isst.
Das echt tuwinische Rezept gibt uns die Köchin Nadeshda Kuntschum, eine große, üppige Blondine, geboren in Krasnojarsk, von wo sie ihr Mann, ein tuwinischer Zahnarzt, nach Kysyl weggeholt hat. Sie haben zwei Kinder, eines zehn, eines fünf Jahre alt. Als ich sie frage, wie es ihr hier gefällt, sagt sie: `Ich habe mich so eingelebt, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, woanders zu wohnen.´- Besonders gefällt ihr die Landschaft Tuwiniens, von der die Köchin schwärmt: ´Hier erstrecken sich unübersehbare Steppen in unmittelbarer Nachbarschaft der Schnee bedeckten Gipfel; Rentiere, deren Artgenossen in der Tundra nahe des Arktischen Ozeans weiden, äsen hier in der Todsha-Senke; Maralhirsche, von denen viele glauben, es gäbe sie nur im Altai, lassen es sich auch in Tuwinien gut gehen, und im Süden ziehen Kamele durch die Sandbarchane, die Wüstendünen. Schneeweiße Bergkuppen, frisches Almgrün, bewaldete Berghänge, fröhlich rauschende Bergflüsse, spiegelglatte Seen, unüberschaubare Weiten - urwüchsige Schönheit, die den Menschen Ruhe und Freude spendet.´
Donnerwetter! An Nadeshda Kuntschun ist ja eine Dichterin verlorengegangen... Sie lacht über dieses Kompliment und ergänzt: `Und noch mehr als die Landschaft gefallen mir den Menschen in Tuwinien - sie sind einander sehr zugetan.´
Nachdem wir so einiges von der Köchin erfahren haben, möchte ich nun aber doch von Marina Smirnowa wissen, wie sie zu ihrem russischen Nachnamen gekommen ist. Bei ihr ist es ähnlich, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen. Sie hat in Moskau Journalistik studiert und sich von dort ihren russischen Mann mitgebracht. Er ist Radiologe, sie haben eine Tochter. Da die Kinder aus gemischten Ehen mit sechzehn Jahren selbst bestimmen, ob sie die Nationalität des Vaters oder die der Mutter annehmen wollen, interessiert mich, wie sich ihre Tochter entschieden hat. `Sie ist Tuwinerin´, antwortet Marina Smirnowa stolz.
Ich erinnere mich noch gut an meine Reise nach Burjatien, Tuwiniens Nachbarrepublik. Damals, 1975, war es durchaus noch nicht an der Tagesordnung, dass sowjetische Europäer sowjetische Asiaten heiraten. Und wenn schon eine gemischte Ehe, dann war in der Regel der Mann ein Burjate und sie eine Europäerin. Zehn Jahre später sucht in der lettischen Zeitung `Rigas Ball´ eine achtundzwanzig Jahre alte Burjatin, `nett und schlank, aufgeschlossen und lebensfroh, gute Hausfrau, mit Hochschulbildung´, einen `klugen, herzensguten, humorvollen Mann´; die Anzeige hat die bezeichnende Überschrift `Nationalität ohne Belang´.
1925 war in der Sowjetunion jede vierzigste Ehe national gemischt, 1975 jede zehnte, 1987 jede siebente; in Kasachstan, Lettland, Belorussland und in der Ukraine ist es bereits jede fünfte. Grund für die unterschiedlich hohen Zahlen ist einerseits der unterschiedlich stark ausgeprägte Nationalstolz, andererseits die unterschiedliche Migration der Bevölkerung. Beträgt die Stammbevölkerung in Lettland um die 50 Prozent, so beträgt sie in Armenien um die 90 Prozent, Mischehen-Ergebnis: in Lettland gleich 20,2 Prozent, in Armenien gleich 3,6 Prozent. Eine Umfrage in Usbekistan ergab, dass rund 20 Prozent der älteren Usbeken eine gemischte Ehe nur dann anerkennen, wenn der jeweilige Partner anderer Nationalität sich an die usbekischen Nationalbräuche zu halten verspricht. `Gemischte Ehen´, meint der Soziologe Professor Maßschud Dshumussow, Experte für die Theorie der nationalen Beziehungen vom Moskauer Akademie-Institut, `wechselten ihren Status von Ungewöhnlichem zu Normalem´.
Eine erstrebenswerte Entwicklung?
Bei kleinen Völkern - wir werden das noch bei den Niwchen auf Sachalin sehen - kann durch die große Zahl von Mischehen sogar der Bestand einer Völkerschaft gefährdet werden. In Tuwinien sind Mischehen bis jetzt nur in den größeren Städten an der Tagesordnung, in den vielen kleinen Dörfern lebt und heiratet man noch vorrangig unter sich. In die größeren Städte jedoch haben `die neuen Menschen´ auch ihre Lebensweise mitgebracht. Und zusammen mit dem elektrischen Licht, dem fließenden Wasser, dem Gasherd, den Stühlen, dem Besteck... hat sich in Stadt und Land vieles an ehemals tuwinisch-asiatischen Bräuchen den russisch-europäischen Verhaltensnormen angeglichen.
Auf der XIX. Unionsparteikonferenz der KPdSU 1988 sprach Michail Gorbatschow in seinem Bericht über die große Mobilität (Migration) der sowjetischen Bevölkerung. `Viele Menschen´, so sagte er, `leben außerhalb der Grenzen ihrer nationalen Strukturen, und Millionen Menschen leben nicht in den für sie bestimmten Territorien.´
Da hat mich denn doch mal interessiert, wie mobil die Sowjetbürger eigentlich sind.
Fünfhunderttausend Menschen siedeln jährlich in der Sowjetunion in andere Regionen um. 85 Prozent der Umsiedler sind jünger als vierzig Jahre, die Mehrheit bilden Zwanzig- bis Dreißigjährige. Über 20 Prozent haben für die Volkswirtschaft wichtige Facharbeiterberufe, 67 Prozent Ober- beziehungsweise Fachschuldbildung: groß ist der Anteil an Ingenieuren. Leider begeben ich jährlich Tausende `auf eigene Faust´ zu einer Großbaustelle, um dann eventuelle zu erfahren, dass sie dort gerade nicht gebraucht werden, woanders aber sehnlichst erwartet werden; man nennt das in der Sowjetunion unorganisierte Migration.´
Besser wäre es, wenn Umsiedlungsinteressenten das sowjetische Arbeitsvermittlungssystem in Anspruch nehmen würden, schließlich betragen die `Erschließungskosten´ für jeden Neusiedler fünfzehn- bis zwanzigtausend Rubel.
Die sowjetischen Völker sind sehr unterschiedlich `mobil´. Am beweglichsten sind die Russen und Belorussen. Die Aserbaidschaner zum Beispiel sind traditionell nicht geneigt, ihre Republik zu verlassen. Man hört in diesem Zusammenhang oft den (nicht ganz wertfreien) Terminus `geographischer Konservatismus´. Eine langsame Änderung zeichnet sich jedoch laut Bericht des Komitees `Amurgebiet und Fernöstliches Küstenland´ ab. Immer mehr Aserbaidschaner reisen an und - bleiben. Bei allen mittelasiatischen Völkern hingegen ist die Mobilität bis auf den heutigen Tag noch sehr niedrig, hier ist wie eh und je Sitte: `Zusammen bleibt die Sippe´.
Über die Mobilität der Tuwiner konnte ich kein Material finden. Doch ich habe auf meinen vielen Reisen keinen einzigen Tuwiner außerhalb seiner Republik angetroffen. Darauf angesprochen antworteten alle so oder ähnlich: `Lernen, studieren woanders, gut, aber leben... unbedingt auf tuwinischer Erde.´
Inzwischen sind wir schon beim dritten Gang unseres Abendessens, Hammel in Gelee, angekommen. Die üppige Mahlzeit lässt mich an die Dürftigkeit und Armut der Jugend Soltschak Tokas denken. Ich erzähle Marina Smirnowa, wie sehr mich sein Buch beeindruckt hat. `Ein besitzloser Tuwine´, so zitiere ich aus dem Gedächtnis und hoffentlich richtig, `durfte nicht einmal aufrecht gehen, er musste seinen Rücken krumm machen, die Arme hängen lassen wie Stricke, immer bereit, sich tief zu verneigen.´
`Was Wunder bei unserer Geschichte´, antwortet Marina. `Erst wurde das Tuwiner-Gebiet von den Hunnen verwüstet, später kamen die Horden Tschinggis-Chans. Vom 13. bis Mitte de 18. Jahrhunderts herrschten die mongolischen Chane, 1758 bis 1911 die mandschurische Qing-Dynastie. 1914 wurde Tuwa - als Urjanchaigebiet russisches Protektorat.´ - `Ging es den Tuwinern da besser?´ unterbreche ich Marina. - `Na, so auf Anhieb war von einer Verbesserung nichts zu merken. Aber immerhin führte diese Verbindung zu Russland zur Entwicklung des Handels. Und mit der Übersiedlung vieler russischer Bauern kam es zu engen Kontakten zwischen unseren beiden Völkern. Außerdem wurden durch die Angliederung an Russland viele Tuwiner in die revolutionäre russische Entwicklung einbezogen. Allerdings nahmen die Tuwiner auch schon früher nicht tatenlos ihre Unterjochung durch fremde Eroberer und die eigenen Feudalherren hin. Da gab es zum Beispiel die Erhebung der Araten von 1883 bis 1885, die unter der Bezeichnung `Aufstand der sechzig Recken` in die Geschichte eingegangen ist. An der Spitze der Rebellen standen der Arate Sambahyk und der kleine Beamte Dashima. Der Aufstand wurde grausam unterdrückt, alle Beteiligten wurden geköpft und ihre Köpfe, auf Pfähle gespießt, zur Abschreckung am Wege aufgestellt. Trotzdem war der ´Aufstand der sechzig Recken´ für die nationale und soziale Befreiung des tuwinischen Volkes höchst bedeutungsvoll. Für uns sind die Kämpfe von 1911 und 1912, die die Befreiung des tuwinischen Volkes von dem eineinhalbhundert Jahre währenden Joch der mandschurisch-chinesischen Eroberer brachten, eine Fortsetzung dieses Aufstandes.´- `Und die sich damals herausbildende nationale Befreiungsbewegung führte unter dem Einfluss der Oktoberrevolution zum endgültigen Sieg, zur Unabhängigkeit?´ - `Ja, mit tatkräftiger Unterstützung der russischen revolutionären Arbeiter. Nach der Niederschlagung konterrevolutionärer Koltschakbanden wurde am 13. August 1921 die unabhängige Volksrepublik Tannu-Tuwa proklamiert. Tannu-Tuwa wurde die zweite Volksrepublik der Welt, gegründet noch drei Jahre vor der Mongolischen Volksrepublik. Darauf sind wir Tuwiner sehr stolz!´
So stolz, dass es uns (trotz Gorbatschowschen Alkoholverbot) gelingt, der poetischen Köchin Nadeshda Kuntschun eine dick mit Zeitungspapier vermummte Sektflasche zu entlocken, die wir selbstverständlich `auf Bude´ leeren müssen.
Wir leeren unsere (Zahnputz-)Gläser perlenden bulgarischen Champagners darauf, dass die Tuwiner seit 1921 beginnen konnten, den Kopf zu heben. `Doch noch mindestens ein Jahrzehnt´, dämpft Marina meinen Optimismus, `schlug sich die Revolutionäre Volkspartei Tannu-Tuwas weiter mit Lama-Aufständen und Schamanenunruhen herum. Erst 1931 konnte man darangehen, die eigenen Feudalherren zu enteignen.´
Darauf können wir leider mangels Masse jede nur noch ein winziges Tröpfchen trinken.
Trotzdem gebe ich mit meinen Fragen noch keine Ruhe, denn die Erfahrung hat mich gelehrt, was man an Fakten hat, das hat man, was man kriegt, das weiß man nicht... Also will ich von Marina noch wissen, wie sich denn die Beziehungen der selbständigen Volksrepublik Tannu-Tuwa zur Sowjetunion gestalteten. - `1925 wurde ein Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion abgeschlossen. Wissenschaftler kamen zu uns, Geologen, Künstler, vor allem Lehrer, Ärzte, Bauarbeiter... In jeder Entwicklungsetappe, die Tannu-Tuwa zu bestehen hatte, stand die Sowjetunion an der Seite der Tuwiner.´
Da es inzwischen auf Mitternacht zugeht, vertagen wir uns auf morgen, um zu sehen, wie aus Belozarsk, der Stadt des weißen Zaren, die Hauptstadt Kysyl, die Rote, wurde."
Die Stadt des weißen Zaren wird rot (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Unser Programm beginnt anderntags mit einer Stadtbesichtigung bei acht Grad Wärme; nicht in jedem Jahr ist im Oktober noch Herbst in Tuwinien. Aber Frost, so Marina, und die Vereisung der Flüsse stehen bereits unmittelbar bevor.
Kysyl, die Rote, wurde 1914 von den Russen gegründet. Wladimir Gabajew, ein hoher Beamte der zaristischen Regierung, war beauftragt, für das neue, dem Russischen Reich angegliederte Gebiet ein administratives Zentrum zu errichten. Er kam mit Ingenieuren, Bauarbeitern, Polizisten, Ärzten; Samowaren, Filzstiefeln, Bügeleisen... und gab der schnell erbauten Holzhaussiedlung den Namen Belozarsk.
Die Mongolen und alle Lamaisten überhaupt, von Tibet bis zu den Kalmyken an der Wolga, nannten den russischen Zaren Tsagan Batur, den Weißen Gewaltigen. Sie sahen in ihm eine Verkörperung einer Gottheit, der weißen Tara. Der Name Belozarsk war also mit Bedacht gewählt. Er sollte den Tuwinern zeigen, dass nicht ein Mensch, sondern ein Gott der Herr des Landes sei, dem sich zu unterwerfen religiöse Pflicht ist. Nun, die Unterwerfung war kurz, obwohl sie nicht gleich 1917 endete, denn auch in Tuwa wechselte die Macht zwischen roten Partisanen und weißen Konterrevolutionären fast täglich, oft stündlich.
Vor der Gründung der Stadt, deren Name Kysyl 1926 auch nicht gerade unbedacht gewählt war, gab es in ganz Tuwinien keine einzige Stadt, keine Siedlung, nur Aals, Gemeinschaften mehrerer Jurten. Die Tuwiner, Hirten durchweg, lebten in Jurten oder Tschums, die Armen `...wie die Tiere des Waldes´.
Doch zurück zur Gegenwart. Marina geht mit uns zuerst ins Kysyls Stadtpark. Auffällig die vielen Bänke. Abgelegen für den Uneingeweihten das `Grab an Jenissej´, wo 1919 Partisanen beigesetzt wurden, die im Kampf gegen Weißgardisten gefallen waren, erst 1964 wurde dort ein Denkmal aufgestellt. Interessant, dass tuwinische Komsomolzen am 29. Oktober 1968 in dieses Denkmal eine Nachricht einmauerten. Fünfzig Jahre später, also am 29. Oktober 2018, zum 100. Geburtstag des Komsomol, soll sie von den dann lebenden Komsomolzen gelesen werden. Zu gern wüsste ich, was darin steht, aber das weiß auch Marina nicht - sagt sie.*
Da ich diese Zeilen schreibe, wird der Komsomol mit seinen 38 Millionen Mitgliedern gerade siebzig Jahre alt. Jetzt in der Zeit der großen Umgestaltung im Sowjetland, darf die Jugend natürlich erst recht nicht abseits stehen.
(...)
Nächstes Ziel unseres Stadtbummels ist der von mir gestern schon am Jenissej entdeckte Obelisk, der erst 1964 aufgestellt worden ist, anlässlich der zwanzigjährigen Zugehörigkeit Tuwiniens zur Sowjetunion. Marina erzählt, dass Carruther den Mittelpunkt Asiens ausgerechnet im Gemüsegarten des russischen Kolonisten Safjanow ermittelt hatte, der sich einen entsprechend beschrifteten Pfahl zwischen seinen Kohlbeeten gefallen lassen musste. Später wurde der Pfosten dann durch eine kleine Pyramid in der Nähe des damaligen städtischen Elektrizitätswerkes ersetzt. Den jetzigen Obelisk errichtete man, nachdem sowjetische Wissenschaftler die Berechnungen Carruthers bestätigt hatten - allerdings etwa zwanzig Meter vom ehemaligen Standort entfernt. Mir scheint, dass diese Korrektur nicht erfolgte, weil Carruther sich um diese zwanzig Meter vertan hatte, sondern weil der vierkantige, sich nach oben verjüngende, zwölf Meter hohe Obelisk mit der pyramidenförmigen Spitze jetzt, direkt am Großen Fluss, einen imposanteren Standort hat. Marina dazu: `Fest steht, dass sich in Kysyl das Zentrum Asiens befindet. Kommt es da auf zwanzig Meter an?´
Eigentlich nicht. Überhaupt - so viel ist mir schon aufgefallen -, pingelig scheinen die Tuwiner nicht zu sein.
Wir gehen weiter in Richtung Stadtzentrum. Es gibt hier wohl alles, was so zu einer richtigen Stadt gehört: natürlich ein Lenindenkmal, sechzehn Denkmäler und Gedenkstätten - verbunden mit den geschichtlichen revolutionären Ereignissen, der Geschichte der Gründung der Tuwinischen ASSR und der des Großen Vaterländischen Krieges -, zwei Museen, vier große Bibliotheken, ein Theater, eine Philharmonie, zwei Paläste der Kultur, zwei Hochschulen (eine pädagogische und eine polytechnische), vier Lichtspielhäuser, zwei Sportstadien, ein Hippodrom, zwei Speisegaststätten, elf Restaurant und Cafés, zehn Warenhäuser, drei Buchhandlungen, eine Stadtauskunft, ein Fernsprechamt, drei Dienstleistungsgeschäfte (`wenn sich doch bloß das Dienstleistungsangebot verbessern würde´, stöhnt Marina), einen Autobusbahnhof mit fünfzehn verschiedenen Linien, eine Schiffsanlegestelle, eine Transportagentur, einen Flughafen, einen Markt, zehn Taxihaltestellen, zwei Linientaxis, Institute, Instanzen, Institutionen und ... Menschengewimmel.
Innerhalb der letzten vier Jahrzehnte hat sich die Zahl der städtischen Bevölkerung Tuwiniens auf das Achtzehnfache erhöht, der Anteil der Städter ist von 6,7 auf 44 Prozent gestiegen. Obwohl also die Mehrzahl der Tuwiner noch immer das Leben auf dem Lande bevorzugt, prägen doch auch tuwinische Gesichter schon das Antlitz dieser großen Stadt.
Wir bleiben noch am Ufer des Jenissej, wo laut Tschechow die originelle, erhabene, herrliche Natur Sibiriens beginnt. `Die eifersüchtigen Bewunderer der Wolga´, schreibt er 1890 in seinem literarisch-dokumentarischen Reisebericht `Die Insel Sachalin´, von dem später noch ausführlich zu berichten sein wird, `mögen es mir nicht verübeln, wenn ich sage, dass ich in meinem Leben keinen prächtigeren Fluss als den Jenissej gesehen habe. Wenn die Wolga eine elegante, bescheidene und schwermütige Schönheit ist, so ist der Jenissej ein mächtiger, ungestümer Recke, der nicht weiß, wohin mit seiner Kraft und Jugend.´
Die Tuwiner lassen es sich etwas kosten, das Ihrige dazu beizutragen, dass ihr Jenissej so sauber bleibt, dass ihnen keine einzige Fischart untreu wird. Sie bringen dafür auch gewisse Opfer, so wurde zum Beispiel der Linienverkehr der Schiffe auf das nötigste beschränkt.
Inzwischen aber ist am Jenissej auch der Bau des Staudamms für das Wasserkraftwerk Sajan-Schuschenskoje, das auch Tuwinien mit Energie versorgen wird, abgeschlossen. Es ist das größte Wasserkraftwerk der Sowjetunion, für das man die gewichtigsten Kräne benötigte; sie mussten statt der herkömmlichen fünfzehn Tonnen Gewicht fünfundzwanzig bewältigen. Man brauchte außerdem die größten Turbinen, die der Leningrader Spezialbetrieb gebaut hat. Die Staumauer ragte, bevor man das Wasser staute, 245 Meter in den Himmel.
Die Elektroenergie des Wasserkraftwerkes wird vor allem für den Territorialen Produktionskomplex Sajan benötigt. Die Länge der Staumauer beträgt 1 066 Meter. `Der Stausee´, sagte Marina, `dient auch als neue Wasserstraße. Am Ufer des künstlichen Meeres werden auf tuwinischem Territorium der Hafen und die Stadt Nowy Schagonar entstehen.´
Der sibirische Schriftsteller Valentin Rasputin, bekannt dafür, sich sehr um die Ökologie Sibiriens zu sorgen, bedauert, dass nun auch noch mit dem Bau eines weiteren Wasserkraftwerke am Jenissej begonnen wird. `Wozu´, fragt er. `Man täte manchmal gut daran, sich an Altes zu erinnern und es auf neue Art anzuwenden. Früher gab es in Russland eine Unmenge von Windkraftwerken und kleinen Wasserkraftwerken an Umführungskanälen. Diese `kleine Energetik´ brachte der Umwelt keinen Schaden, verriegelte nicht den Hauptstrom und bewahrte das Leben in den Flüssen.´
Die Meinung Rasputins - sie mutet anachronistisch an - erinnert mich aber doch an meine Reise zu den Tschuktschen und asiatischen Eskimos im äußersten Nordosten der Sowjetunion, nur durch die achtzig Kilometer breite Beringstraße von Alaska getrennt. Wie stolz war man noch 1980 auf die sogenannten Wesdechods, die `Lastwagen´ mit Raupenketten, mit denen man so modern über den Tundraboden rasen konnte. Doch man hat zum Glück sehr schnell herausgefunden, dass diese Geländegängigen die Vegetationsdecke für Jahrzehnte zerstören. Hätte man nicht gerade noch rechtzeitig zum altbewährten Hundeschlitten als Haupttransportmittel zurück gefunden, würde schon heute die einzige Nahrungsquelle der 750 000 Rentiere Tschukotkas - das Tundramoos - das im Jahr nur einen einzigen Millimeter wächst - nicht mehr ausreichen...
Als ich Marina gegenüber meine Bedenken äußere, was man dem Recken Jenissej so zumute, nickt sie sorgenvoll, sagt dann aber: `Bei uns in Tuwinien hat es fünfzehn Jahre lang nicht ausreichend geregnet. Unsere Landwirtschaft bezeichnen wir offiziell als `Risiko-Landwirtschaft´; denn wir wissen nie, ob aufgeht, was wir säen. Da versprechen wir uns natürlich sehr viel von dem Sajano-Schuschenskojer Wasserkraftwerk.´
Ende Dezember 1986 lese ich unter der Überschrift `Tuwinien erhält Strom von Sajan-Schuschenskoje´, dass eine der kompliziertesten Montagen von Energiefernleitungen, die bisher in der Sowjetunion durchgeführt wurden, in Südsibirien abgeschlossen worden sei. `Vom größten Wasserkraftwerk der UdSSR, dem Jenissej-Giganten Sajan-Schuchenskoje, wurde eine rund 300 Kilometer lange 220-kV-Leitung über das mehr als 3 000 Meter hohe Sajangebirge nach der tuwinischen Hauptstadt Kysyl gelegt. Während des Baus waren der Riesenfluss Jenissej, steile Gebirgszüge, Zonen ewigen Frostes und ausgedehnte Sümpfe zu überwinden.´
Diese Leitung ist bereits die zweite, die Tuwinien mit dem einheitlichen sowjetischen Energienetz verbindet, sie soll wesentlich dazu beitragen, die Industrie Tuwiniens zu entwickeln.
Im Sajaner Gebiet hat der Jenissej eine Wassertiefe von 80 Metern, überhaupt sind der Jenissej und seine Zuflüsse die tiefsten Zuflüsse der Sowjetunion. `Und wenn schon vom Wasser geredet wird´, um noch einmal Rasputin, einen meiner sowjetischen Lieblingsautoren, aus seiner Novelle "Der Brand" zu zitieren, `so ist das ja bekanntlich nicht dann sauber, wenn es wirklich sauber ist, sondern wenn man es sauber sehen will. Dazu braucht man sich nur eine ausgeklügelte Optik auf die Nase zu setzen.´
Hoffentlich haben die Tuwiner die richtige Optik auf der Nase, um mit Recht so zuversichtlich zu sein, dass die `Kraft der Jugend´ des hier zur Welt kommenden Vaters Jenissej ausreicht, dem besorgniserregenden ökologischen Schicksal des `schwermütigen´ Mütterchen Wolga zu entgehen.
Gottlob wird ein langfristiges staatliches Programm für Umweltschutz und rationelle Nutzung von Naturressourcen für die ganze Sowjetunion auch umfängliche Maßnahmen zum Schutz des Jenissej bis zum Jahre 2005 vorsehen.
Auf dem Rückweg macht uns Marina auf ein kleines, unscheinbares Haus aufmerksam. `In diesem Gebäude´, erzählt sie, `tagte 1941 der Kleine Chural, auf dem Saltschak Toka die Tuwiner aufforderte, den Sowjetsoldaten jegliche Unterstützung zuteil werden zu lassen. Heute steht dieses Haus unter Denkmalschutz, es beherbergt unser Heimatmuseum.´
`Gehen wir doch rein´, schlage ich vor.
Marina schaut ein wenig verlegen drein, dann sagt sie: ´Gut, aber ich habe Sie erst für morgen angemeldet. Wollen sehen, wer heute da ist.´ Gleich im Vorraum fällt uns ein großes Gemälde auf. Es zeigt Saltschak Toka vor dem Obersten Sowjet der UdSSR, als er im Namen seines Volkes den Antrag um Aufnahme Tannu-Tuwas in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vorträgt. Das war im August 1944. Am 13. Oktober wurden diesem Wunsch entsprochen.
Die Museumsdirektorin Tatjana Sodman findet ganz und gar nichts dabei, dass wir heute unangemeldet statt morgen angemeldet erscheinen. Nach herzlicher Begrüßung auf das Gemälde weisend, vermerkt sie stolz, dass aus dem bettelarmen Saltschak Toka ein bekannter Staatsmann geworden sei, der jahrzehntelang seiner Republik vorstand. Das wusste ich zwar schon, aber das meiste, was dann kommt ist neu für mich, trotz meiner umfangreichen Reisevorbereitungen.
Übrigens: Nirgendwo lasse ich ein Heimatmuseum aus, erfahre und sehe ich doch hier in relativ kurzer Zeit, was ungezählte Emsige in wer weiß wie langer Zeit an Fakten und Sehenswertem zusammengetragen haben. Jedes Mal betrete ich ein so ehrbares Gebäude mit den erwartungvollsten Gefühlen und verlasse es, als hätte ich auf eigenem Buckel Klaviere geschleppt. Hätte ich - wie so oft die Märchenhelden - drei Wünsche offen, wäre einer: auf meinen Reisen in allen Museen in einem bequemen Sessel sitzend, von Exponat zu Exponat, von Vitrine zu Vitrine, von Diagramm zu Diagramm gerollt zu werden. Oh, wie könnte ich mich da auf all das Vorgetragene konzentrieren, all das Sehende genießen, und wie leicht entzifferbar könnten mein Notizen sein.
So aber werde ich abends wieder einmal wie nach jedem Museumsbesuch, alles fein in reine schreiben müssen.
`Archäologen´, beginnt Tatjana Sodman den Museumsmarathon, `finden in Tuwinien Denkmäler der materiellen Kultur aus fernsten Epochen. Sie lassen erkennen, dass den Perioden historischen Aufschwungs immer wieder, oft Jahrhunderte dauernd Phasen gesellschaftlichen Niedergangs folgten. Schon vor etwa tausend Jahren gab es hier zum Beispiel Inschriften auf Steinen, aber sie gerieten in Vergessenheit. Siedlungen, Tempel, Festungen verwandelten ich in Ruinen. Die Bevölkerung verringerte sich stark.´
Und nun hält Tatjana Sodman einen blutrünstigen Vortrag über Horden und Banden, die hier mit Feuer und Schwert eingedrungen waren.
`Ein menschenwürdiges Leben´, fährt sie fort, `musste aus dem Nichts geschaffen werden. Der lese- und schreibunkundige nomadisierende Viehzüchter, dessen Vorfahren weder Buch, Theater noch Arzt gekannt hatten, stand vor der Aufgabe, den Sprung in die Zivilisation zu bewältigen. Bei den europäischen Völkern nahm das Jahrhunderte in Anspruch. Die Tuwiner mussten diesen Weg in wenigen Jahrzehnten durchmessen. Dabei unternahmen sie die bedeutendsten Schritte auf diesem Weg in den letzten vierzig Jahren, nachdem sich Tannu-Tuwa freiwillig der UdSSR angeschlossen hatte. Ich betone ausdrücklich: freiwillig. Uns `wilden Waldbewohnern´ der Region Urjanchai war zwar nach der Revolution das Selbstbestimmungsrecht gewährt worden, aber es stellte ich heraus, dass unsere eigenen Möglichkeiten nicht ausreichten, um die grundlegenden Entwicklungsprobleme zu lösen. Unser wichtigster Volkswirtschaftszweig, die Landwirtschaft, beruhte auf der Viehzucht der Araten; und die Genossenschaften konnten wegen ihrer schwachen technischen Basis keinen wesentlichen Produktionszuwachs sichern.
Anders zum Beispiel verlief die Entwicklung bei dem mit uns verwandten Volk der Chakassen, von dem die vorrevolutionären Zeitungen schrieben, dass es keine zwanzig Jahre mehr existieren und restlos aussterben werde. Weil das chakassische Volk aber vom ersten Tag der Gründung seines Territoriums an zur Sowjetunion gehörte, hat es das Antlitz seines Landes gleich von Grund auf verändern können. Ähnliches erlebten auch unsere Brudervölker, die Altaier und Burjaten.
Tannu-Tuwa hatte übrigens schon 1941 den Antrag gestellt, in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken aufgenommen zu werden. Wegen des Krieges wurde die Entscheidung jedoch aufgeschoben. Und trotzdem gingen tuwinische Gardereiter und Panzersoldaten als Freiwillige in die Rote Armee. Im Laufe des Krieges, so berichtet die etwa dreißigjährige Tatjana Sodman uns abschließend, schickte die Volksrepublik Tannu-Tuwa, die selbst nichts im Überfluss hatte, fünf Züge an die Front, das waren 385 Waggons mit Weizen, warmen Sachen, Skiern...; außerdem wurden der Roten Armee etwa 50 000 Pferde zur Verfügung gestellt, und es wurde Geld für drei Flugzeuggeschwader gesammelt; den Kolchosbauern der Ukraine sandten die Tuwiner 30 000 Stück Vieh.
`Dort, der Panzer, ein T 34´, sagt Marina auf unserem Weg zurück in Gästehaus, `wurde zum Gedenken an den Krieg aufgestellt.´
Mir gefällt nicht, dass ich Kinder genauso respektlos auf dem Panzer herumtollen sehe wie gestern die Kleinen auf den großen Holzplastiken. Aber keiner der Vorübergehenden findet etwas dabei, und so sage ich mir, dass es schließlich gut ist, wenn Kindern Krieg nicht dasselbe bedeutet wir mir, die ich ihn miterlebt habe.
* Und niemand wird erfahren, was dort geschrieben steht; denn einen 100. Geburtstag des Komsomol wird es nicht geben...
Das Atmen gelehrt (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
Heute, verspricht Marina am nächsten Morgen, würde sie uns poetisch kommen, sie habe ein Treffen für uns im Schriftstellerverband vereinbart. Auf dem Weg dorthin treffen wir einen Mann, einen Bekannten Marinas und - wie wir schnell bemerken - einen Bekannten ganz Kysyls. Ich habe noch keinen Menschen so oft in so kurzer Zeit zurückgrüßen sehen. Rossislaw Dokuroolowitsch ist Komponist, Mitglied des Komponistenverbandes seit 1978, seit seiner Gründung. Bevor uns Marina also poetisch kommen kann, kommt er uns musikalisch, erzählt von seiner ersten Oper, seinem ersten Musical, seiner ersten Operette...
Als wir mit zwei Stunden Verspätung im Schriftstellerverband eintreffen, ist den wartenden Autoren keinerlei Verstimmung anzumerken.
Marina erzählt, dass wir Rossislaw Dokuroolowitsch getroffen haben. Der Vorsitzende des Verbandes, Kysyl-Enik Kyrdys Kudashai, antwortet lachend, er wisse aus eigener Erfahrung, dass man ihm nicht ausweichen könne.
Dann berichtet er über die Geschichte seines Verbandes. Der Schriftstellerverband der Tuwinischen ASSR wurde 1942 gegründet, bereits zwölf Jahre, nachdem der belorussische Gelehrte Professor Palmbach für die Tuwiner eine Schriftsprache entwickelt hatte. `Erst schrieben wir mit lateinischen Buchstaben, seit 1940 wird auch die tuwinsche Schriftsprache mit kyrillischen Schriftzeichen realisiert, das Tuwinische hat drei zusätzliche Zeichen.´
Da ich von Buchlesungen weiß, dass viele Leser sich darüber wundern, weshalb man von einer jeweils eigenen Schriftsprache der sowjetischen Völker spricht, obgleich fast alle das kyrillische (russische) Alphabet benutzen, scheint es mir angebracht, an dieser Stelle einmal ausführlicher darauf einzugehen.
In der Sowjetunion sind weit über einhundert Nationen, Völkerschaften und ethnische Gruppen vertreten. Jedes Volk hat seine eigene mündliche Hochsprache, mehr als siebzig Sprachen verfügen auch über eine Schriftsprache, die meisten Völker erhielten sie nach der Oktoberrevolution.
Die Vielsprachigkeit ist wohl auf keinem sowjetischen Territorium so ausgeprägt wie in der Dagestanischen ASSR im Nordkaukasus. Ein vielgereister Handelsmann schrieb in seinem auf uns überkommenen Tagebuch, dass er nur zwei wirklich bunte Dinge auf der Welt kenne - das Kopftuch einer Negerin von Haiti und die ethnographische Karte Dagestans: Mehr als dreißig dagestanische Völkerschaften und ethnische Gruppen sprechen hier in neunundzwanzig Sprachen und siebzig Dialekten.
Um die Vielzahl der Sprachen zu erklären, erzählt man in Dagestan diese Legende: Da ritt vor langer Zeit ein Sendbote Allahs durch das dagestanische Land. Sein über die Schulter geworfener Sack war voller Sprachen, die er verteilen sollte. Als ein so schwerer Schneesturm aufkam, dass er und sein Pferd sich nicht mehr auf den Beinen halten konnten, schüttelte der ungetreue Bote den schweren Sack einfach über die Felsen aus, auf dass der wilde Sturm gleich hier auf dagestanischer Erde alle Sprachen verteile.
In Wahrheit boten die hohen Berge den einzelnen Siedlungen nicht nur Schutz vor feindlichen Überfällen, sonder sie behinderten auch den Kontakt zwischen den einzelnen Stämmen. Und so sprachen und sprechen denn die Bergbewohner vieler Schluchten und sogar einzelner Auls auf ihre Weise.
Über die Sprache der kleinen Völker entbrennt immer mal wieder ein heftiger Disput, beispielsweise darüber, ob es sich bei einer bestammten Sprache überhaupt um eine selbständige Sprache handelt oder nur um einen Dialekt. Ebenso verhält es sich mit der Schriftsprache. Viele Sprachen haben in den zwanziger und dreißiger Jahren ein Alphabet bekommen. Doch das hat manchen Völkern nicht geholfen, eine eigene Schriftsprache aufzubauen, zum Beispiel den Schoren in der Altairegion. Die Menschen bedienten sich des Russischen und vergaßen darüber bald ihre eigenen Schriftzeichen. `Daher sind das´, sagt Dr. A. N. Baskakow, Mitarbeiter des Akademie-Instituts für Sprachwissenschaften, `für uns keine Schriftsprachen. Recht schwierig ist es auch festzustellen, wenn eine Sprache Schriftsprache wurde. Vor der Oktoberrevolution verwendeten beispielsweise viele der neunzehn Sprachen, die zur Gruppe der Turksprachen gehören, das arabische Alphabet. Mit Errichtung der Sowjetmacht stellte man sich aber auf die kyrillischen Schriftzeichen um. Wo sind sie nun einzustufen? Gehören sie in die Gruppe der alten Schriftsprachen oder in die der neuen?
Ich möchte hier nur die Sprachen nennen, die vor der Oktoberrevolution überhaupt keine Schriftsprache hatten, sie jetzt jedoch aktiv gebrauchen. Es sind über vierzig, unter anderen: Abasinisch, Abchasisch, Awarisch, Adygeisch, Altaiisch, Baschkirisch, Burjatisch, Gagausisch, Darginisch, Inguschisch, Kabardinisch, Kalmykisch, Karakalpakisch, Balkarisch, Kirgisisch, Komiisch, Komi-Permjakisch, Kumykisch, Kurdisch, Lakisch, Lesginisch, Mansisch, Mariisch, Nanaiisch, Nenzisch, Niwchisch, Nogaiisch, Saamisch, Tabassaranisch, Tuwinisch, Chakassisch, Chantisch, Tscherkessisch, Tschetschenisch, Tschuktschisch, Ewenkisch, Ewenisch, Ersja-Mordwinisch, Eskimoisch, Jakutisch, Jukagirisch, Selkupisch, Tofalarisch... (...)
Nach dieser linguistischen Abschweifung hören wir jetzt aufmerksam Kysyl-Enik Kyrdys Kudashi zu:
`Der Schriftstellerverband wurde von Saltschak Toka, dem Ersten der tuwinischen Literatur, gegründet. Als Kysyl noch aus drei Dutzend Holzhäusern bestand, war er mutterseelenallein hierhergekommen, um zu lernen. Nachdem 1921 die Volksrepublik Tannu-Tuwa ausgerufen worden war, ging er zur Armee, danach machte er sich auf den langen Weg nach Moskau; einen Monat brauchte er damals für diese Wegstrecke, für die man heute nur Stunden benötigt. Nach seiner Rückkehr wurde Saltschak Toka Sekretär des Zentralkomitees der Revolutionären Volkspartei.´
Als der Schriftstellerverband 1942 von dem Tuwiner Toka gegründet wurde, hatte er neun Mitglieder, acht davon waren Russen. Heute hat der Verband 15 Mitglieder, davon sind drei russischer, einer burjatischer und elf tuwinischer Nationaliät. Von den elf Tuwinern stellt sich uns Leonid Tschadamba als der Ältete vor; im Verband ist er seit 1945. Leonid Tschadamba wurde 1918 in einem Tschum geboren, seine Mutter starb, als er drei Jahre alt war. Als der Vater starb, war er acht. Sie waren elf Kinder, sechs kamen über das Kleinkindalter nicht hinaus. Leonid Tschadamba wurde, wie seine überlebenden Geschwister, von Verwandten aufgezogen. Bis 1929 lebte er im Tschum, in einem solchen, wie ihn Saltschak Toka beschreibt´. Mit 14 Jahren lernte er in der neugegründeten Schule schreiben und lesen, sein Lehrer war der Belorusse Professor Palmbach. `Er hat mich das Atmen gelehrt´, sagt Leonid Tschadamba. Mit 18 Jahren wurde er - nach Abschluss der Kysyler Pädagogischen Fachschule - selbst Lehrer, einer der ersten tuwinischen. Er blieb es achtzehn Jahre lang. Dann arbeitete er im 1945 gegründeten Kysyler Institut für Sprache, Literatur und Geschichte, wurde 1962 sogar Direktor des Instituts. Drei Legislaturperioden lang war er Deputierter des Obersten Sowjets und bis Mitte der achtziger Jahre Verantwortlicher Sekretär des Tuwinischen Friedenskomitees. Seine Frau ist Journalistin, sie haben acht Kinder, vier Jungen und vier Mädchen. Was wurden sie, deren Vater hungernd und frierend im Tschum aufgewachsen war? Sie arbeiten als Lehrer, Arzt, Topograph, Buchbinderin, Regisseurin, Handelsleiterin, Kulturwissenschaftlerin, Banja ist Schüler der zehnten Klasse.
Leonid Tschadamba fühlt sich in seiner Lyrik ganz seiner tuwinischen Heimat verbunden; am liebste besingt er die Landschaft. Tuwinien ist reich an Flüssen und Seen; es gibt über achttausend Flüsse und mehr als 430 kleine und große Seen, der größte See ist der Asas. `Mit Fug und Recht´, sagt Marina, `wird er als Tuwas `Perle´ bezeichnet.´ Marina schwärmt von der herbstlichen Farbenpracht, der winterlich eisigen Stille, dem Frühlingserwachen und den sommerlichen Wohlgerüchen. `Jede Jahreszeit hat am Asas ihren eigenen Reiz. Sonnenstrahlen spiegeln sich im Wasser verändern die Färbung der Berge, der Taiga und der Wolken.´
Im Laufe der Jahre habe ich viele Einladungen zu einem zweiten Besuch in die verschiedensten Ecken der Sowjetunion bekommen. O ja, ich möchte schon noch einmal zu den Eskimos, nach Dagestan, nach Adygien natürlich, wo mein Patenkind Gisela Chamersokowa inzwischen 13 Jahre alt ist - aber allzu gern möchte ich noch einmal nach Tuwinien, nach Todsha und dann endlich auch zum Asas, wo wir, leider, ausschließlich aus Zeitgründen, nicht hingekommen sind.
Leonid Tschadamba sieht diesen märchenhaft schönen See in seinem Gedicht so:
Wie Gold überm Wasser / der Sonnenuntergang, / und goldene Schlösser / die Kimmung entlang. // Das Gold rieselt nieder, / den See hat´s erfasst - / geschmolzene Sonne / füllt jetzt den Asas. // Der Blick unterscheidet / den Wasserrand kaum / dort fern von des Himmels / rotglühenden Saum. // Rings alles verzaubert, / so seidig und weich - / der See einem riesigen / Blütenkelch gleich. // Er winkt uns verlockend / und lacht unbeschwert. / Wer hat seine Wellen / das Atmen gelehrt? // Drum strahle, bis später / der Abend verblasst, / du märchenhaft schöner, geliebter Asas. //
Nachdichtung aus dem Russischen von Johann Warkentin
Die einzige Frau unter den elf Literaten tuwinischer Nationalität ist Jekaterina Tuktugoolowna Tanowa, dem Verband gehört sie seit 1973 an. 1932 in einer Jurte geboren, wechselte sie mir ihren Eltern - Viehzüchter waren sie - viermal jährlich den Weideplatz; im Winter bewohnten sie bereits ein festes Haus; heute lebt sie in der großen Stadt. Jekaterina Tanowas Mann ist Lehrer, einer ihre beiden Söhne wurde ebenfalls Lehrer, und zwar an der Kysyler Musikschule, der andere Beleuchter beim Tuwinischen Fernsehen. Jekaterina Tanowa, sie schreibt Balladen, Gedichte, Poeme, am meisten liebt sie historische Themen.
Saltschak Toka sagt in seinem Buch: `Ich konnte nicht begreifen, dass außer den Einwohnern von Tuwa noch andere Menschen existieren.´ Für Jekaterina Tanowa ist die Heimat um vieles größer geworden; ich fand ihr Gedicht `Heimatland´; einige Zeilen daraus:
Wer könnte dir im Leben mehr bedeuten / als deine Mutter, die zur Welt dich brachte? / Und welches Fleckchen Erde wär dir lieber / als das, wo du die ersten Gehversuche machtest? // Die Liebe zu dem heimischen Stück Erde - / sie ist´s, was mich auf meinem Weg begleitet. / Auf starken Schwingen trägt mich diese Liebe, so flieg ich frei durch alle Landesweiten. // Weit sind die Wege durch die Riesenheimat, / doch hin zu meinem Ursprung führen alle. / `Grüß dich, Kysyl-Taiga!´ da kommt das Echo vom Kaukasus und vom Ural her schallend. / `Mein Mütterchen Chemtschik!´ so ruf ich zärtlich; / flugs melden sich der Jenissej, die Wolga. / `Süt-Chol´, so frag ich, `bist du meine Wiege?´ - / und weiß, die Antwort wird vom Kaspi folgen.
Nachdichtung aus dem Russischen von Johann Warkentin
Marina, durch den gelassen aufgenommenen unangemeldeten Besuch im Heimatmuseum und durch unsere heiter hingenommene Verspätung beim Schriftstellerverband kühn geworden, schlägt uns vor, schon heute mal bei Raissa Araktschaa vorbeizuschauen, obwohl wir auch hier eigentlich einen späteren Termin haben. Raissa Araktschaa, so sagt uns Marina, sei Steinschnitzerin, die berühmteste unter allen berühmten tuwinischen Steinschnitzern.; früher ist es übrigens nur Männersache gewesen, Figuren aus Speckstein zu schnitzen. Speckstein, auch Bildstein oder Gipsstein, heißt wissenschaftlich Agalmatolith. Es gibt diesen Stein nur in ganz wenigen Gebieten der Welt. Dass er rosa, beige, hellbraun, ocker, grau, schneeweiß oder anthrazitschwarz ist, hören wir schon von Raissa Araktschaa selbst, die uns ohne viel Umstände empfangen hat. `Die schneeweißen und die anthrazitschwarzen sind die wertvollsten´, sagt sie, `da sie am seltensten sind, allerdings auch am härtesten. Seit alters schnitzen die Tuwiner aus Agalmatolith Tiere ihrer Umwelt, auch Phantasielebewesen und Alltagsszenen.´ Dass sie Mitglied des tuwinischen Künstlerverbandes, Repin-Preisträgerin und Verdiente Künstlerin der RSFSR ist, erfahren wir von Marina, aber Raissa Araktschaa unterbricht sie, indem sie darauf hinweist, dass es inzwischen in Kysyl noch eine Frau gäbe, eine viel jüngere Kollegin, selbst Tochter eines Steinschnitzers, die ihr Handwerk vom Vager erlernt habe. `Das ist eben schon eine andere Generation. Bei mir war noch alles Zufall. Ich bin irgendwann Mitte der sechziger Jahre dem damals bekannten Steinschnitzer Chertek begegnet, der mich `entdeckte´. Am meisten imponierte ihm wohl meine Ausdauer.´
Es ist schwer, an das Gestein heranzukommen. `Dreihundert Kilometer von Kysyl entfernt ist es zu finden, und man muss sehr gut reiten können, geht es doch ganz hoch und steil in die Berge. Mit Hacke und Pickel wird der Stein aus der Wand gebrochen und dann in Kiepe und Rucksack auf dem Rücken zurücktransportiert.´ Diesen Weg muss man oft zurücklegen, um die dreihundert bis fünfhundert Kilogramm zusammenzutragen, die man im Jahr verbraucht.
Zu den Instrumenten der Schnitzerin gehören ein kleiner, sehr feiner und harter Maurerhammer mit scharf geschliffenen Kanten, eine Bügelsäge, zahlreiche kleine, sehr scharfe, aus Hartstahl gefertigte Messer und - ein Skalpell, zum Schutz der Hand mit Isolierband dick umwickelt, nur die rasierklingenscharfe Spitze ist frei gelassen.
Zur Erinnerung schenkt mir Raissa Araktschaa einen sitzenden Steinbock. Unvorstellbar, wie fein das Gehörn geschnitzt ist. Auf meinen Hinweis, dass ich auch sehr grobe Arbeiten gesehen hätte, antwortet sie bescheiden: `Wir haben alle einmal angefangen, es braucht Jahrzehnte, bis man es sehr gut kann.´ Die Meisterin bildet jährlich zwei Lehrlinge aus, jeder ist glücklich, wenn er bei ihr lernen darf."

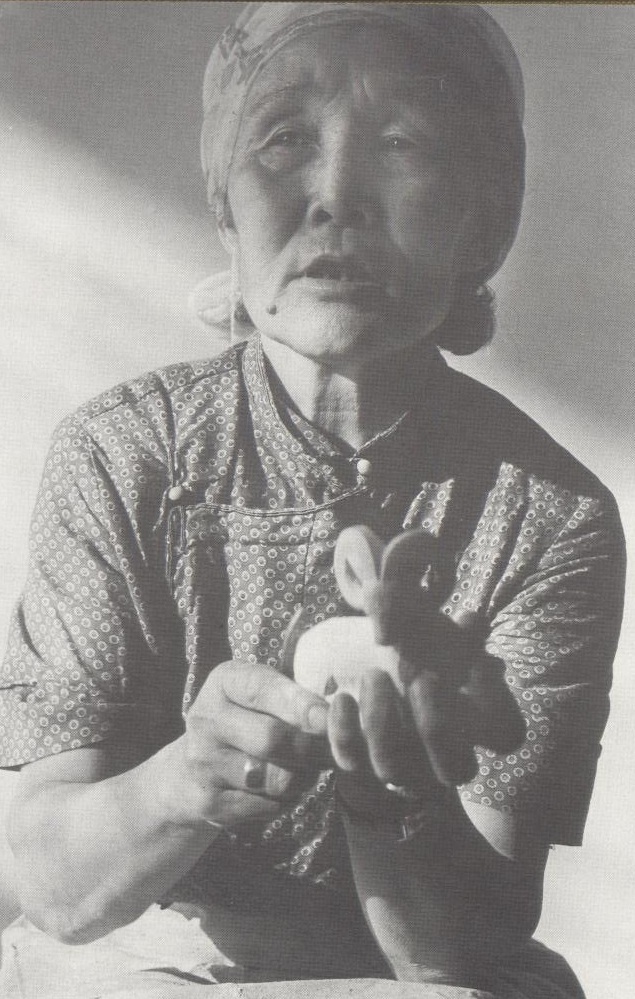
Eine der Skulpturen von Raissa Arakscha, der berühmtesten tuwinischen Speckstein-Schnitzerin.
Skulptur aus: Rellers Völkerschafts-Archiv, Foto: Detlev Steinberg;
Saltschak Toka – so erfahre ich fast ein Vierteljahrhundert später - hat mit 28 Jahren mit sowjetischer Unterstützung gegen die Regierung von Donduk Kuular, dem ersten tuwinischen Ministerpräsidenten, der vorher ein lamaistischer Mönch war, geputscht und nach dessen Hinrichtung 1932 die Macht in der Tuwinischen Volksrepublik übernommen. Unter seiner Führung wurde die Landwirtschaft, die bislang nomadisch war, kollektiviert. Die traditionellen Religionen (Schamanismus und Lamaismus/Buddhismus) wurden von ihm entschieden unterdrückt. Toka führte um sich – nach dem Vorbild Stalins - einen bizarren Personenkult ein. Bis zu seinem Tode im Jahre 1973 war er Generalsekretär der tuwinischen KPdSU. Seine Ehefrau Chertek Antschimaa-Toka war von 1940 bis 1944 Oberhaupt Tuwiniens – das erste weibliche Staatsoberhaupt weltweit. Sie starb 2008 mit 96 Jahren.
Von der Machtlosigkeit des Uhrzeigers (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Ungeduldig haben wir unsere erste Fahrt ins Landesinnere erwartet. Sie soll uns nach Don-Teresin, wohl an die zweitausendfünfhundert Meter hoch, zu einer Herde Yaks und ihrem Gebieter führen.
Als wir wie immer ohne eine Minute Verspätung des Auto besteigen, frage ich Marina: `Kann man sagen, dass die Tuwiner ausgesprochen pünktliche Leute sind?´
Marina schmunzelt: `Wir glauben, Pünktlichkeit den sprichwörtlich pünktlichen Deutschen schuldig zu sein... Draußen auf den Weiden, Sie werden es heute noch zu spüren bekommen, hat der Uhrzeiger keine große Macht über die Tuwiner.´
Da heißt es, mit der Tür nicht in die Jurte zu fallen.
Sechs Stunden wird die Fahrt nach Don-Teresin dauern. Detlev Steinberg, der Tuwinien das zweite Mal bereist, war Nina Charitonowa* und mir schon beinahe lästig geworden mit seiner Schwärmerei über die An- und Ausblicke, die sich unseren Augen bieten würden. Nina schimpfte sogar: `Sei endlich still, ich will mir mein eigenes Bild machen.´
Und dann machen wir uns ein eigenes Bild: Die Straße führt am Jenissej entlang. Hier strömt er breit und gewichtig dahin. Rechts und links der Straße, mal zum Greifen nahe, mal scheinbar in die Ferne gerückt durch Weiden oder Felder, die Kette des Sajangebirges. Später fährt die Straße serpentinenartig mitten durch das Gebirge. Da die Berge jetzt direkt vor und hinter uns aufragen, hat man stets das eigenartige Gefühl, sich in einem hermetisch abgeschlossenen Talkessel zu befinden, obwohl wir doch genau wissen, dass hinter uns eine Zufahrt sein muss, denn schließlich sind wir ja gerade erst hindurch gefahren.
Die dicht aufeinanderfolgenden Bergketten sind wunderbar gefärbt. Die untere leuchtet grün, goldgelb und weiß durch die Kiefern und Zirbelkiefern, die herbstlich eingefärbten Lärchen und die geraden Stämme der Birken, ihre Blätter haben die meisten schon abgeworfen; die folgende Reihe, nur noch Strauch bewachsen, zeigt kräftige rote und braune Oktoberfarben; dann werden die Berge gigantisch-steinig, nahezu unbewachsen; der Abschluss ist schneeweiß, von der Sonne umspielt, die von einem strahlend-blauen Himmel gelassen auf all das scheint, auch auf uns, die wir soviel Schönheit nicht fassen können. Dazu immer wieder Viehherden, zu Pferde der Hirt, fast immer in der traditionellen farbenprächtigen tuwinischen Tracht, meist von einer Meute Hunde umtobt.
Nina Charitonowa, bisher verliebt in die Berge des Kaukasus, sagt immer wieder: `Na so was´ oder `Das kann´s doch nicht geben.´
Ich sage gar nichts. Am liebsten wäre ich jetzt ganz allein...
Und der Uhrzeiger, der hat nun auch über uns `sprichwörtlich pünktliche Deutsche´ seine Macht verloren.
Wieder und wieder bittet einer von uns anzuhalten, unbedingt anzuhalten! Es sieht komisch aus, wenn wir uns dann wie die Kreisel drehen, um die Rundumsicht zu genießen.
Detlev, der in den Bergen herumklettert, um zu fotografieren, ruft uns zu sich in die Höhe. Er hat auf einem Hügel an einem kleinen Flüsschen einen Steinhaufen entdeckt, der nur von Menschenhand hier zusammengetragen worden sein kann. Durch unseren Besuch im Kysyler Heimatmuseum wissen wir, dass dies sogenannte Owaa sind, Steinhaufen zu kultischen Zwecken, auf Bergen, an Pässen und markanten Wegstellen aufgeschichtet, um eine örtliche Gottheit zu verehren. Es ist Sitte, als Vorüberkommender einen Stein dazuzulegen. Der eine oder andere gibt seinen Stein sicherlich auch heute noch aus kultischen Gründen, aber bei den meisten ist dies wohl einfach nur noch Tradition. Wir jedenfalls wünschen uns mit den Steinen, die wir dazulegen, auch weiterhin Glück auf dem Weg.
Dann rufe ich, weil ich vor einer Jurte einen anscheinend erst kürzlich grob behauenen Stein stehen sehe, einen Menschen vom Kopf bis zur Hüfte darstellend. Im Museum hatte man uns erzählt, dass solche Steine - zum Teil bemerkenswerte Kunstwerke - böse Geister milde stimmen sollten. Die jahrhundertealten Steingebilde hat man überall in der Steppe gefunden, sie zieren in langen Reihen den Museumshof. Noch immer wundert man sich, wie die Menschen sie dazumal in die Steppe geschafft haben. Die Furcht vor den bösen Geistern konnte offensichtlich Steine versetzen...
Der Hirt, den wir fragen, ob sein nicht gerade geschichtsträchtiges Denkmal für irgendwelche Geister bestimmt sei, verneint entschieden, sagt, die Umgebung seiner Jurte sehe so schöner aus.
Die Tuwiner glaubten früher am manche gute und viele böse Geister. Den guten Geistern brachte man Verehrung und Opfer dar, um sich ihres Schutzes zu vergewissern, die anderen suchte man durch allerhand Vorkehrungen fernzuhalten - von der Jurte, von der Familie, vom Vieh, von sich selbst, vor allem aber von den Kindern. Alle abwehrzauberischen Praktiken zu nennen ist unmöglich, denn die Phantasie der Tuwiner kannte keine Grenzen. Nehmen wir als Beispiel nur die Namensgebung, weil sich Spuren davon bis in die heutige Zeit finden lassen. Um Einfluss auf die Geister zu nehmen, gab man den Kindern Namen, die zum Ausdruck bringen sollten, dass der, der ihn trägt, es nicht wert ist, dass der böse Geist sich um ihn bemüht: Dyrtyk-Uwaa (krummes Baby), Myjakban (Scheißdreckchen), Galdar-ool (Rotzjunge), Ozrukban (Fürzchen); einige der schützenden Namen hatte neben der abstoßenden zugleich auch eine abschreckende Funktion, zum Beispiel: Elee (Geier), Dsherling (Wilder), Mangys (Bezeichnung des Ungeheuers in der tuwinischen Folklore). Absolut feststehende Jungen- und Mädchennamen gab es nicht. Dem Namen, der für einen Jungen bestimmt war, hängte man oft die Silbe -ool an, dem für ein Mädchen die Silbe -kys. Solche Namen begegnen einem in Tuwinien auch heute noch allerorten. Neu ist, dass das einst nur männliche -ool aus des Vaters Vornamen inzwischen auch im Vatersnamen der Tochter auftaucht. Die Vatersnamen haben die Tuwiner von den Russen übernommen. Erinnert sei an die Lyrikerin Jekaterina Tuktugoolowa Tanowa. Die Tuwiner tragen Vatersnamen seit etwa dreißig Jahren.
Ortsgottheiten, gute Geister, böse Geister..., da ist es wohl an der Zeit, etwas über den Glauben der Tuwiner zu sagen. Seit dem 17. Jahrhundert war in Tuwa der Lamaismus, eine Form des Buddhismus, verbreitet, der vorher herrschende Schamanenkult blieb allerdings bis ins 20. Jahrhundert lebendig. So waren noch im Jahre 1931 mehr als siebenhundert praktizierende Schamanen in Tuwa registriert. Dem Schamanismus liegt der Glaube vieler primitiver, vielleicht besser gesagt, ungebildeter Völker zugrunde, der Mensch könne mit unsichtbaren Mächten Beziehungen aufnehmen und sie beeinflussen. Das geschah durch magische Tänze, Beschwörungsformeln Autosuggestion, oft unter Einwirkung verschiedener Narkotika. Vermittler zwischen diesen unsichtbaren Mächten und den Menschen waren die Schamanen. Der letzte ´echte große tuwinische Schamane´, so schreibt der Moskauer Ethnologe Wainschtein, starb ende der sechziger Jahre, `nachdem man sich in einem Krankenhaus lange aufopferungsvoll um den alten Mann bemüht hatte´.

Schamanenkostüm und Schamanentrommel.
Zeichnung: Karl-Heinz Döhring
Doch von den Schamanen wieder zurück in die Gegenwart! wir sind ja noch immer auf dem Weg zu dem Hirtenehepaar Oorshan, und Marina blickt so streng, wie sie es vermag, auf die Uhr. Aber wir, inzwischen wissend, dass der Uhrzeigen in den Bergen des Sajan keine Macht besitzt, trödeln weiter. Da klingt aus der Ferne ungewöhnlicher Gesang zu uns herüber. Vermutlich ein Hirte, der sich sein Alleinsein mit einem sogenannten Zweilautgesang verschönt. Die Nordmongolen beherrschen diesen sonderbaren Singsang, außerdem die Chakassen, Ostaltaier, Baschkiren und Tuwiner. Am stärksten verbreitet ist er in der Tuwinischen ASSR. Bei diesem Zweilautgesang singt ein einzelner Mensch so, dass es sich anhört, als würden zwei Männer zugleich singen: der eine mit einem niedrigen Hauptlaut, der andere mit einem höheren Pfeiflaut. In Kysyl hatten wir schon einigen Zweilautsängern gelauscht, einen konnten wir kurz sprechen: Arbai-ool Chertek. Von klein auf hatte er versucht, den Zweilautgesang von seinem Vater zu erlernen, aber es gelang ihm nicht. `Da glaubte ich´, sagt Arbai-ool Chertek, `es gehört eine bestimmte Veranlagung dazu, und man braucht besondere Stimmbänder.´
Im Komponistenverband hatte man uns Schallplatten geschenkt mit Aufnahmen der berühmtesten Zweilautsänger Tuwiniens. Und man hatte uns erzählt, dass ähnlich wie Abai-ool Chertek auch die Wissenschaftler lange Zeit angenommen hätten, die Sänger müssten besondere Stimmbänder haben. Dann aber wurde 1975 das Phänomen des Zweilautgesangs erforscht. Das Ergebnis exakter Untersuchungen der Stimmorgane und des Kehlkopfs war, dass der Stimmapparat der Zweilautsänger sich anatomisch nicht von denen anderer Menschen unterscheidet. Allerdings wurde ein bisher unbekannter Mechanismus des Stimmapparates beim Zweitlaufgesang festgestellt. Danach bilden sich im Kehlkopf beim Herauspressen der Luft zwei Verengungen. Die untere wird normal von den Stimmgändern gebildet, die obere Verengung entsteht, wenn Kehlkopfknorpel und Kehldeckel sich nähern, die Stimmbänder abdecken und in der Mitte nur eine Öffnung von einem bis anderthalb Millimetern frei bleibt.
Mir ist es herzlich egal, wie der herzbetörende Gesang entsteht, der jetzt aus der Steppe zu uns herüber klingt. Ich glaube, einen Dudelsack zu hören, ein Waldhorn, eine Maultrommel, eine Querflöte... Die Tuwiner selbst nennen den Gesang Chöömej: Kehlkopfgesang.
Jahrhundertealt ist die Tradition, die die Väter verpflichtet, die Kunst des Zweitlaufgesangs an die Söhne weiterzugeben. Als dem Vater Arbai-ool Cherteks die Forschungsergebnisse zu Ohren gekommen waren, begann er aufs neue mit seinem Sohn zu üben. Heute ist Arbai-ool Chertek ein begabter Zweilautsänger, sogar berufsmäßig am Musikalisch-Dramatischen Theater in Kysyl.
Übrigens: Lediglich in Tuwien beherrschen heute nicht mehr nur die Söhne die Kunst des Zweilautgesangs, sondern auch die Töchter.
Wir verlassen jetzt die asphaltierte Straße, und mehr oder weniger querfeldein geht es mit dem erstaunlich geländegängigen `Wolga´ noch kilometerweit durch Waldschneisen und über von Stein zu Stein sprudelnde Bäche höher und höher hinauf zur Jurte des Ehepaars Oorshan."
* Detlev Steinberg (Bildreporter) und Nina Charitonowa (Reisebegleiterin aus Moskau) waren mit mir mit von der Partie auf der Tuwinien-Reise.
Zu Gast in einer Jurte (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Die Oorshans versorgen bei Don-Teresin, hoch oben in den Bergen, dreihundertvierzig Yaks; für ihren persönlichen Bedarf tummeln sich hier außerdem Schafe und Ziegen.
Weiß ist die Jurte, die das Hirtenehepaar bewohnt. Einst erkannte man schon an der Farbe, ob in der Jurte jemand lebte, der genug zu essen hatte oder nicht, denn die Jurte eine Reichen war mit weißem Filz gedeckt, die des Armen mit schwarzem. Gut, dass vor mir schon der deutsche Forschungsreisende Mänchen-Helfen seine Ahnungslosigkeit bewiesen hatte, als er fragte, warum denn nur die Reichen weißen Filz herstellten. Er schreibt: `Die Tuwiner haben mich gehörig ausgelacht. Jeder Filz ist ursprünglich weiß. Der schwarze Filz ist nur schwarz geworden durch Rauch und Schmutz. Der Arme kann eben die Jurtendecken nicht so oft erneuern.´
Ob in Jurte oder Haus, grundsätzlich wird man in Tuwinien mit Milchtee bewirtet, dem eine Prise Salz beigemengt ist; es ist Ziegeltee - Tee minderwertiger Sorte, zu einem `Ziegel´ gepresst -, vor der Zubereitung wird er in einem Mörser zerkleinert. Kommt man nur auf einen Sprung, wird Boorsak, ein in Fett gesottenes Gebäck aus Mehl, Wasser, Butter und etwas Salz angeboten. Oft stellt man auch noch Zucker dazu und Trockenquark. Erscheint ein besonders lieber oder weitgereister Gast, dann muss unbedingt ein Schaf dran glauben. Wir sind etwa siebentausend Kilometer weit gereist, also wird es glich einen Hammel weniger auf der Welt geben. Indes er von hilfsbereiten Nachbarn geschlachtet, abgezogen, ausgenommen und zubereitet wird, habe ich Muße, mir die Jurte der Oorshans anzusehen. Sie ist neunwandig und - sehr geräumig, fast dreißig Quadratmeter groß. Den oberen Abschluss der Jurte bildet der Rauchöffnungsreifen. Heute ist es warm, die Tür steht offen, und der Rauch beißt nicht in die Augen. Im Winter kann man mit dem Rauch schon seine Plage haben.
In dem Rauchöffnungsreifen befinden sich die Dachstangen. Das Holzgerüst der Jurte ist mit großen Filzstücken bedeckt, bei den Oorshans sind es ihrer neun. Ein quadratisches Filzstück, das bei gutem Wetter zurückgeschlagen wird, verschließt bei Regen, Kälte und nachts die Rauchöffnung; es ist eine Art Fenster. Die Türen bestehen heute meist aus Holz, früher verdeckte eine Filzmatte den Eingang. Im Dör, der Tür gegenüber, stehen große, buntbemalte Truhen, tuwinisch sind es Abdyraa. Hier bewahrt man Felle und Kleidung auf, überhaupt alles, was für die Familie kostbar ist. Außerhalb der Hauptstadt begegnen einem der Tuwiner und die Tuwinerin noch heute in der Nationaltracht - dem Tonn oder dem Deel.
Waren die Truhen im Dör, dem Ehrenplatz, früher oft mit Heiligenbildern geschmückt, so sind sie heute meist mit Blumen und Ornamenten bemalt. Bei den Oorshans zieren die Truhen und Schränkchen dreiteilige Spiegel, sechs an der Zahl. Was für eine eitle Familie... Dalgantschyk Oorshan lächelt: `So oft gucken wir da gar nicht hinein, aber wir finden es schön, und - es ist modern.´
Modern ist es auch, neben den Truhen Koffer jeder Größe zu besitzen, die, übereinander gestapelt, ebenfalls Hab und Gut der Familie aufnehmen. Für mich sind diese Koffer symbolischer Hinweis darauf, dass Hirten und Viehzüchter oft `auf Reisen´ gehen. Heute sind die Tuwiner nicht mehr Nomaden im früheren Sinne. Sie leben sommers mit den Tieren auf den Weiden und wohnen winters in festen Siedlungen, die Tiere sind dann in Stallungen untergebracht. Auch die Oorshans haben im Ort Don-Teresin ein festes Haus, aber sie sind dort selten, denn die Tiere, die sie zu versorgen haben, fühlen sich selbst im kalten, schneereichen Winter hoch oben in den Bergen so richtig yakwohl.
Die linke Seite der Jurte ist die Seite des Mannes. Hier werden Sattel- und Zaumzeug, Waffen und Fallen aufbewahrt. Wenn es sehr kalt ist, finden dort auch die Jungtiere ein warmes Plätzchen.
Auf der rechten Seite sind Hausrat und Nahrungsmittel untergebracht, hängen Fleischstücke an den Stangen der Wandgitter und steht der aus geräuchertem Leder genähte Sack, in dem Butter zubereitet und Stutenmilch zu Kumys gegoren wird. Aus Kumys destilliert man Branntwein, den etwa zwölfprozentigen Araga. Dieses traditionelle Getränk und dazu noch Bosha, das ist gekochter Chojtpak - eine Art Kumys aus Yak-, Schaf- Ziegenmilch -, Smetana - köstliche dicke saure Sahne - und im Mörser zerkleinerte Hirse mit Yakmilch übergossen, stehen für uns bereit. Man bittet uns zuzugreifen, achtet aber ganz und gar nicht gastfreundlich-lästig darauf, dass wir in alles gleichermaßen `reinhauen´. Nur das erste Glas Araga, das möchte man doch gemeinsam austrinken - jeder wünscht damit jedem das Beste. Alle Speisen, die einem gereicht werden, erhält man grundsätzlich mit der rechten Hand dargeboten, und man nehme sie unbedingt mit der rechten Hand entgegen. Ganz tuwinisch ist es, beim Austausch der Speisen den rechten Arm mit der linken Hand leicht zu stützen.
In der Jurte der Oorshans stehen zwei Metallbetten. Die Enkelkinder kriechen zu Großvater und Großmutter, die selbstverständlich bei ihren Kindern wohnen, mit ins Bett. Kommen einige der anderen acht erwachsenen Kinder zu Besuch, so macht man es sich in warmen Fellen auf dem mit Teppichen ausgelegten Boden bequem.
In der Mitte der Jurte befindet sich unter der Rauchöffnung der Herd, der einst aus drei Herdsteinen bestand (und meist kräftig rußte), später aus einem Gestell mit eisernem Kessel. In den Jurten hat man heute transportable Öfen. Der Herd und das Feuer wurden, wie bei vielen Völkern, besonders verehrt. Deshalb, Großvater Oorshan erinnert ich noch daran, konnten sich viele Hirten lange nicht entschließen, einen modernen Ofen anzuschaffen. Wie konnte man das Herdfeuer, das vor dem Erfrieren bewahrte und die warme Mahlzeit ermöglichte, einsperren... Außerdem war nach den alten schamanischen Glaubensvorstellungen alles, was in der Welt existierte, beseelt, auch der Herd, auch das Feuer. Allmorgendlich - so erzählt der Großvater - sei dem Herdfeuer ein Spritzopfer dargebracht worden vom ersten aufgebrühten Milchtee. Erst dann trank man selbst. Im Museum hatte man uns den `Neunäugigen´ gezeigt: eine Holzscheibe mit einem langen Stab daran. In der Holzscheibe sind neuen Vertiefungen, symbolisch für die neun tuwinischen `Haustiere´: Rind, Schaf, Ziege, Kamel, Pferd, Rentier, Yak, Hund, Katze. Diesen Stab tauchte man wie einen Löffel in den Milchtee und gab auch den genannten Tieren ihr Spritzopfer, allen auf einmal - wie zweckmäßig.
Heutzutage müsste der `Neunäugige´ ein `Zehnäugiger´ sein; denn die tuwinischen Haustiere haben Zuwachs bekommen: das Huhn. Das Huhn galt im alten Tuwa als exotisches Tier. Heute betreiben einige Sowchosen auch Geflügelzucht.
Dieweil der Hammel - für unsere mitteleuropäische Ungeduld - gar zu lange braucht, um aufgetragen werden zu können, gehen wir mit dem Hausherrn Cerot Oorshan näher heran an die Yakherde. Von weitem sehen seine Tiere ganz friedlich aus. Sobald man ihnen jedoch näher kommt, werden sie unruhig und schließen sich zu einer Art Kampfformation zusammen. Jeden Schritt, den man auf sie zugeht, weichen sie zurück, ohne ihre Verteidigungsstellung aufzugeben. Wenn allerdings nur Cerot Oorshan weitergeht, zeigen sie keinerlei Abwehrreaktion, sie grunzen sogar freudig.
Wie soll man einen Yak beschreiben? Vielleicht so: Er hat den Körper einer Kuh, den Kopf eines Bisons, den Schwanz eines Pferdes, das bauchmähnige Haarkleid einer Wildziege, und er grunzt wie ein Wildschwein, weshalb man dieses Urrind auch Grunzochse nennt. Die Schwänze der Yaks waren einst hochgeschätzt, ihre seidigen Strähnen dienten, gerahmt in einer Goldfassung, orientalischen Herrschern als Fächer; außerdem zierten sie die Speere der Heerführer. Der Haus-Yak gilt als halbgezähmt, aber zu dicht sollte man sich nicht heranwagen. `Ohne ersichtlichen Grund´, sagt Cerot Oorshan, `kann er angreifen, und wehe dem, den er auf die Hörner nimmt.´ Die Hörner des Yaks, die seitlich geschwungen nach oben verlaufen, können bis zu neunzig Zentimeter lang werden. Sein Körper erreicht eine Länge von 4,25 Metern, eine Höhe von 1,90 Metern und ein Gewicht von mindestens siebenhundert Kilogramm.
Unser Gastgeber bezeichnet diese halbwilden Verwandten des Hausrindes liebevoll als `erstaunliche Wesen, wundervoll für sein Leben im Hochgebirge geschaffen´.
Die dünnen Lippen und Hornpapillen auf der Zunge ermöglichen es den Yaks, so kurzes Gras abzurupfen, wie es sonst nur Schafe und Ziegen fressen können. Sie haben mehr rote Blutkörperchen als andere vergleichbare Tiere und können deshalb mehr Sauerstoff aufnehmen. Ihre Herzen und Lungen sind stärker entwickelt, und sie besitzen ein zusätzliches Rippenpaar. Feste Hornvorsprünge an den Hufen wirken wie Hufeisen. Es ist überraschend, wie leichtfüßig diese gewichtigen Tiere laufen und springen können. Sehr zum Kummer der Hirten übrigens entfernen sich die flotten Tiere oft ziemlich weit, was dramatisch werden kann, wenn die Zeit des Kalbens gekommen ist. Dann erweist sich erst, wer ein wirklich guter Hirt ist. Die Yak-Kälbchen werden nämlich oft fern von der Herde, direkt im Schnee, geboren.
"Wie viele Kälbchen haben Sie denn so eingebüßt?´ frage ich Cerot Oorshan. - `Mir ist auch in diesem Jahr kein einziges Kälbchen verlorengegangen´, antwortet er.
Wie dies möglich ist, weiß nur Cerot Oorshan, der seit mehr als drei Jahrzehnten Hirt in den Bergen ist, jeden Weg und Steg kennt und außerdem mit den Gewohnheiten jedes einzelnen Tieres vertraut ist.
Es sei daran erinnert, dass die Herde aus dreihundertvierzig Tieren besteht! Aber der Hirt Oorshan meint, das seien dreihundertvierzig Einzelwesen, und jedes habe `sein eigene Gesicht´. Wohl zum Beweis zeigt er auf die Herde und sagt: `Da haben sich zwei Tiere von den Nachbarn dazwischengemogelt.´ Nun weiß ich zwar, dass die Tiere aus unterschiedlichen Herden unterschiedliche Schnittzeichen in den Ohren haben, aber die kann man aus dieser Entfernung wirklich nicht ausmachen.
Als Marina mein zweifelndes Gesicht sieht, sagt sie: `Für mich als Städterin grenzt das Unterscheidungsvermögen der Araten hinsichtlich ihres Viehs auch an ein Wunder.´
Na, wenn das so ist... Was sollen wir europäischen Stadtbewohner dann davon halten.
Der Yak gibt Fleisch, Milch, Butter, Fell, Wolle, Leder. Wir hatten schon Yakbutter in Tee gekostet, sie ist ein wenig talgig, und Yakfleisch - mir schmeckt es zu streng, etwas bitter, vielleicht ist der Geschmack einfach nur ungewohnt.
Ungewohnt ist es für uns auch, wie wir nun - wieder in der Jurte - alle gemeinsam dem endlich zubereiteten Hammel zu Leibe rücken. Man sitzt auf dem Fußboden, hier stehen auch die dampfenden Schüsseln - eine mit Brühe, eine mit gekochten Hammelknochen, eine mit Blutwurst, eine mit gefüllten Därmen. Die Schälchen und Schüsseln gehen reihum, man langt mit den Händen zu und - lässt es sich schmecken...
Bevor wir abfahren, macht uns Marina darauf aufmerksam, mit welcher Sicherheit schon fünf- bis sechsjährige Kinder wissen, welches Yak-Kälbchen, Lämmchen oder Zicklein zu welchem Muttertier gehört."

In Tuwinien gibt es keine Altersheime. Hier werden Großvater und Großmutter grundsätzlich in der Familie aufgenommen - wie auch Großvater Oorshan. Übrigens hat die russische Schapka gegenüber der traditionellen kegelförmigen Kopfbedeckung der Tuwiner inzwischen meist den Sieg davon getragen...
Foto: Detlev Steinberg
Wie Ösküs-ool den bösen Geist austrieb (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Wir sind wieder in Kysyl, meine tuwinische Minka hat schon auf mich gewartet. Erwartet werden wir heute auch von Juri Küsegesch, dem Chefredakteur des Buchverlages.
Das Gründungsdatum des Verlages ist der 27. Juni 1930. Keinen Tag, so sagt Juri Küsegesch, habe man versäumen wollen, nachdem die Tuwiner endlich ein eigenes Alphabet hatten. Im ersten Jahr erschienen drei Bücher in tuwinischer Sprache, Fibeln für die tuwinischen Kinder der 1. bis 3. Klasse. 1939 kam das erste belletristische Buch heraus, Alexander Puschkins "Die Hauptmannstochter". Bis 1940 arbeiteten die Redakteure, Wissenschaftler und Lehrer für den Verlag ohne Honorar.
Seit über drei Jahrzehnten ist Juri Küsegesch Chefredkteur. `Heute´, sagt er, `veröffentlichen wir jährlich sechzig bis siebzig Titel in einer Gesamtauflage von etwa 430 000 Exemplaren. Die Auflagen schöngeistiger Bücher in tuwinischer Sprache betragen jeweils etwa fünftausend Exemplare. Da ist oft schon ein Tag nach der Auslieferung kein Exemplar mehr aufzutreiben. Gestern wurde ein Märchenbuch ausgeliefert, ich glaube nicht, dass es heute noch zu kaufen ist.´
Natürlich gehen wir nach unserem Gespräch gleich in die große, zweistöckige Buchhandlung... Und tatsächlich, eine Stunde zuvor war das letzte Märchenbuch verkauft worden.
Der Verlag hat inzwischen acht Bände tuwinischer Märchen verlegt. Jahr für Jahr machen sich Wissenschaftler des Instituts für Sprache, Literatur und Geschichte auf den Weg zu den Jurten und schreiben auf, was Jahrhunderte lang nur mündlich weitergegeben wurde: Lieder, Sagen, Legenden, Märchen. Früher wurden die Märchen meist nach dem Abendmelken erzählt. `Da konnte eine Nacht durchaus so lang werden´, hatte Juri Küsegesch gesagt,, `wie heute oftmals ein Fernsehabend.´ Ich stelle mir einen solchen Märchenabend allerdings anheimelnder vor.
Viele Märchen der Tuwiner sind rau, hart, manche ausgesprochen grausam. Doch - auch das Leben der Tuwiner war rau und hart und grausam.
Ich fand Tiermärchen, Alltagsmärchen, Märchen vom dummen, bösen Mangys, Zaubermärchen und Reckenmärchen. Ein Held begegnet uns immer wieder: Ösküs-ool, ein Waisenjunge. Seine Gegenspieler sind immer Reiche, Khane, Fürsten, oft böse Geister, manchmal Schamanen. Aber wie bei unseren Märchen - die ja auch nicht gerade zimperlich sind - ist eines gewiss, immer siegt das Gute, auch in dem Märchen
Wie Ösküs-ool den bösen Geist austrieb:
*
Es lebte einmal in einem in einem Tschum aus Birkenrinde am Ufer des Flusses Tschinge-Kara-chem ein Bursche, der hieß Ösküs-ool. Außer einem Zottelpferdchen konnte er nichts auf der Welt sein eigen nennen. So jagte er die Tiere der Taiga und sammelte Saranawurzeln. Davon lebte er. - Eines Tages aber wurde er es leid, so allein im Wald zu hausen, und er zog hinaus in die weite Welt, sein Glück zu suchen. Er ritt flussabwärts, bis er auf die Jurte des Schamanen Kaschpydai stieß. Da stieg er von seinem Zottelpferdchen und ging hinein, grüßte höflich und setzte sich ans Feuer. Überm Feuer kochte Fleisch im Kessel, so dass Ösküs-ool das Wasser im Munde zusammenlief. Der Schamane wird doch einen Gast nicht ohne Bewirtung wegschicken, dachte er bei sich.
Der Schamane aber guckte vor die Jurte. Als er das Zottelpferdchen gewahrte, stöhnte er auf und sagte: "Oje, Ösküs-ool! Ich spüre, viele, viele Sünden hast du auf dich geladen. Die bösen Geister haben sich deiner bemächtigt. Aber ich, der große Schamane Kaschpydai, will dir helfen, ich werde sie austreiben!" - Und er begann nach Schamanenart, die Schellentrommel zu rühren, Zaubersprüche zu rufen und um Öskül-ool im Kreise herumzutanzen. Lange ging das so. Dann aber stimmte der Schamane ein lautes Klagelied an: "Oje, Ösküs-ool! Fest haben dich die Dämonen im Griff. Oje, sie wollen nicht vor dir lassen. Niemand auf der ganzen Welt kann sie austreiben, nur ich, Kschpydai. Aber du musst dein Zottelpferdchen opfern. "
Wie Ösküs-ool das hörte, vergaß er seine Angst und sagte: "Mein Zoottelpferdchen gebe ich um nichts in der Welt her, ich habe es von meinem Vater geerbt." Mit diesen Worten ritt er hungrig zurück in seine Waldeinsamkeit.
Der habgierige Schamane Kaschpydai aber fand keine Ruhe, so sehr gelüstete es ihm nach dem Zottelpferdchen. Er ritt Ösküs.ool nach, machte im Dickicht, unweit des Tschums, ein Feuer und wartete die Nacht ab. Dann verkleidete er sich als Ungeheuer, griff sich ein glimmendes Scheit, polterte gegen die Wände des Tschums und schrie mit fürchterlicher Stimme: "Wach auf, Ösküs-ool! Ich bringe dich zu Mangys, auf dass er dich für deine Sünden verschlinge! A-aaa! U-aaa!" Ösküs-ool sprang vom Lager auf, nahm seine Peitsche mit rotem Griff, stürzte aus dem Tschum und prügelte mutig auf das Ungeheuer ein, was das Leder hielt.
"Au, oje! Mache das nicht, Ösküs-ool, ich bin der Schamane Kaschpydai."
Ösküs-ool aber stellte sich taub und schlug weiter auf ihn ein. Halbtot schleppte sich der große Schamane Kaschpydai zu seiner Jurte. Ösküs-ool aber hatte seither nie mehr Angst, auch nicht vor noch so bösen Geistern.
*
Die tuwinische Sprache ist nur eine der 92 Sprachen sowjetischer Völker und Völkerschaften, in denen in der Sowjetunion seit 1917 (bis 1987) 3,6 Millionen Bücher und Broschüren mit einer Gesamtauflage von etwa 63,4 Milliarden Exemplaren verlegt wurden - insgesamt in 165 Sprachen der Welt.
Doch bei der Buchherstellung, dem Buchverkauf und vor allem bei der Auswahl der zu veröffentlichenden Bücher gab es in der Zeit der Stagnation eine Menge Schwierigkeiten, so dass im Zuge der Umgestaltung 1986 ein Institut gegründet wurde, das sich gezielt mit diesen Unzulänglichkeiten beschäftigt. So stellte es eine Liste von Autoren, die aus verschiedenen Gründen selten verlegt wurden, zusammen. Michail Nenaschew, seit 1986 Vorsitzender des Staatlichen Komitees der UdSSR für Verlagswesen, Polygraphie und Buchhandel, nennt in einem Gespräch einige solcher Autoren: Anna Achmatowa, Michail Bulgakow, Wladimir Wyssozki, Boris Pasternak... Und - wichtig auch für die Tuwiner - man beschloss inzwischen, wie Michail Nenaschew, einer der vielen neuen Männer in Führungspositionen, betont, die Auflagen der nationalen Werke zu erhöhen.
Ein weiteres sehr zählebiges Problem des sowjetischen Buchwesens ist die sogenannte graue Literatur, Bücher, die in den Regalen der Buchhandlungen verstauben, keine Käufer finden. In den sowjetischen Literaturzeitungen wird heute viel darüber diskutiert, dass zweitrangige Bücher in zu hohen Auflagen erscheinen.
`In den Zeitungen und Zeitschriften unseres Landes´, bemerkt Michail Nenaschew, `wird heute mit einem Vergrößerungsglas auf die Buchproduktion geschaut. Annähernd siebzig kritische Veröffentlichungen, die durchaus auch einander widersprechen, sind 1987 allein über das Buchwesen erschienen.´
In einer Analyse sei das Komitee zu der Auffassung gekommen, dass der Verlagsprozess der grundlegenden Veränderungen bedürfe. Er sei, so wurde festgestellt, nicht in der Lage - so unbeweglich und aufgebläht, wie er ist -, operativ auf die Anforderungen der Leser zu reagieren. Der Durchlauf der Manuskripte sei mit einem Zaun von Abstimmungen, Befürwortungen, Gutachten umstellt worden. All das behindere das Erscheinen interessanter, origineller Arbeiten.
`Bei all diesen Mängeln´, so sagt Michail Nenaschew weiter, `gehen wir nicht den Weg vieler Verlage kapitalistischer Länder. Wir wollen - indem wir die Erforschung des Leserbedarfs vervollkommnen - der Herausgabe von notwendigen und nützlichen Büchern die Priorität geben. Uns geht es nicht vorrangig um Verkauf und Gewinn! Die demokratischen Umgestaltungen auf unserem Gebiet verfolgen das Ziel, den Verlagen eine maximale Selbständigkeit zu geben, ihre Initiative zu entwickeln.´
In einem Interview mit dem Leipziger `Börsenblatt für den deutschen Buchhandel´ äußert Nenaschew in der Nummer 36/1988 folgende bemerkenswerte Gedanken: `Wir wollen Glasnost zu einem untrennbaren Bestandteil des Verlagsprozesses machen. Und dieser Verlagsprozess muss in der Rückkoppelung vom Leser zum Buchschaffen unter Kontrolle der Öffentlichkeit stehen... Indem wir die Idee der Selbständigkeit der Verlage sowie die Demokratisierung der Beziehungen zwischen Verlag und Autor entwickeln, empfehlen wir bei Meinungsverschiedenheiten, die Arbeiten in der Autorenfassung herauszugeben; dann wird an geeigneter Stelle formuliert, dass der Verlag die Standpunkte des Autors nicht teilt. Wir brauchen frische, originelle Ideen ohne glättendes Redigieren, wir brauchen Bücher, die Meinungen, Dialoge, Polemiken enthalten. Letztlich hat der Autor ein Recht auf seinen Standpunkt, denn er trägt dafür die volle Verantwortung.´
Und weiter ist zu lesen: `Heutzutage ist der Zyklus der Herausgabe und Produktion des Buches bei uns in der Sowjetunion von der Idee bis zur Auslieferung für zwei bis drei Jahre geplant. Natürlich ist so das Buch nicht in der Lage, auf heutige Fragen zu reagieren. Aber wir brauchen Bücher mit Dialogen, mit Reportagen, die direkt die Bedürfnisse der zu erlebenden Ereignisse widerspiegeln. Solche Publikationen brauchen wir schnell, nicht erst in mehreren Jahren, wenn das gesellschaftliche Interesse an ihnen vorbei ist...
Wie viele Leute lesen bei uns ein Manuskript, bevor es realisiert wird? Es lesen Lektoren, Gutachter, Verlagsdirektoren. Und wenn sich der Autor mit ihrer Entscheidung nicht einverstanden erklärt, dann beginnt alles von vorn. Wie viel Kraft kostet das für beide Seiten, zu welchen moralischen und zeitlichen Verlusten führt das...´
Ich sprach schon damals mit Juri Küsegesch über das Thema der `grauen Literatur´.
`Wissen Sie´, hatte er mir geantwortet, `man muss da meine Erachtens zwei Aspekte sehen. Es gibt Erhebungen, die davon ausgehen, dass die meisten Menschen in ihrem Leben höchstens sechshundert Bücher lesen. Da darf niemand seine kostbare Zeit für das Lesen literarisch minderwertiger Bücher vergeuden. Aber was sind minderwertige Bücher? Und die andere Seite ist, dass es doch nicht normal sein kann, wenn viele begehrte Bücher von einem Tag zum anderen ausverkauft sind.´
In der Kysyler Buchhandlung hatte ich - selbst gelernte Buchhändlerin - sozusagen eine Berufskollegin gefragt, wie sie die Situation auf dem sowjetischen Buchmarkt einschätze. Ihre Antwort: `Die Verkaufsfrist für ein Buch beträgt bei uns in der Sowjetunion maximal fünf Jahre. Leider werden längt nicht alle Bücher während dieses Zeitraums auch tatsächlich verkauft. Aber: Was dem einen Ladenhüter, ist dem anderen ein großer Fang.
´Was ich an Ort und Stelle sogleich bestätigen kann, denn ich erstehe hier in Tuwinien endlich `Die Petroglyphen Gorno-Altais´, vor vier Jahren erschienen. Überglücklich halte ich Altaibegeisterte das verstaubte Buch in Händen. `Sehen Sie´, kommentiert die tuwinische Buchhändlerin, `ich finde es falsch, sich nur auf reißend weggehende Bücher zu orientieren, denn dann würden vielen Lesern dringend benötigte Bücher vorenthalten werden, eben jene Bücher, die in den Regalen der Buchhandlungen stehen und - wenn auch angestaubt - geduldig auf ihre Käufer warten.´
Während der halben Stunde, die wir im Buchladen waren, haben zwölf Kunden nach dem bewussten Märchenbuch gefragt. Alle verließen verärgert die Buchhandlung, einer sagte: `Wieder eine Ware des täglichen Bedarfs (1), die nicht zu bekommen ist.´
Und Michail Nenaschew bestätigt in seiner Publikation `Das Buch im Dienste der Umgestaltung´, dass Bücher in der Sowjetunion in eine Reihe gestellt werden mit solchen Massenbedarfsgütern wie Kleidung und Schuhwerk."
Entflammt für Unbrennbares (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Es war einst, vor langer, langer Zeit. Da lebten starke und gute Menschen in Eintracht und Frieden. Sie weideten und züchteten ihr Vieh und erfreuten sich an der wunderschönen Landschaft. Eines Tages aber verdunkelten schwere Staubwolken den Himmel und die Sonne. Die Staubwolken wurden von vielen Pferdehufen aufgewirbelt, denn grausame Krieger brachen von Süden her ins Land er Tuwiner ein. Von Mittag bis Sonnenuntergang und von Sonnenaufgang bis Mittag und noch einmal solange und noch einmal solange schwirrten die Pfeile, brachen die Speere, floss das Blut. Als der letzte Rest der starken und guten Menschen tot vom Pferd fiel, verbarg die Sonne ihr Angesicht hinter den Bergen. Da befahl der Khan der grausamen Krieger, die Witwen, die Greise und die Kinder der guten Menschen auf den höchsten Bergesgipfel zu treiben und sie dort allesamt zu verbrennen.
Die Erde krümmte sich vor Leid.
Der Himmel weinte.
Die Sonne versank.
Doch die Herzen der guten Menschen verbrannten nicht, sie verwandelten sich in ewige Steine - in Asbest.
Diese Legende erzählt man uns im Förder- und Aufbereitungswerk `Tuwaasbest´, in Ak-Dowurak, unserem zweiten Ziel über Land. Vier große Fundstätten gibt es gegenwärtig in der Sowjetunion, ein Fundort befindet sich in der `Stadt der Weißen Erde´, wie Ak-Dowurak zu übersetzen ist.
Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, liegt ein solcher ewiger Stein vom tuwinischen Tagebau in Ak-Dowurak vor mir als Andenken auf meinem Schreibtisch. Was in dem Stein schichtweise seidenartig glänzt, ist das `Unverbrennbare´, `Unzerstörbare´, wie Asbest (´asbeston´), aus dem Griechischen übersetzt, heißt. Aus vielen schriftlichen Überlieferungen geht hervor, dass Asbest seit etwa zweitausend Jahren bekannt ist und gebraucht wird. Zeugnisse dafür finden sich bei dem griechischen Bildhauer Kallimachos (um 400 v. u. Z.), dem römischen Dichter Plinius d. Ä. (23 bis 79), dem griechischen Dichter und Philosophen Plutarch (um 46 bis 120) sowie dem ebenfalls aus Griechenland stammenden Dichter Pausanias (um 110 bis um 180). Damals schätze man besonders die bis dahin unbekannten Eigenschaften - die Faserstruktur und die Unbrennbarkeit - bei der Fertigung von Dochten für Tempellampen. Der römische Kaiser Nero (37 bis 68) war besonders stolz auf seine Asebestservietten und Karl der Große (742 bis 814) auf sein aus Asbestfasern gewebtes Tafeltuch.
Über die regelmäßige Nutzung von Asbest bei den mongolischen Völkern schreibt Marco Polo (1254 bis 1329) in seinen Reiseberichten. Die Tuwiner zum Beispiel wussten die außerordentlichen Eigenschaften des Asbestes zu schätzen, schon lange bevor hierher übergesiedelte russische Bauern am felsigen Ufer des Kara-Dasch um die Jahrhundertwende zufällig Asbest entdeckten. Die tuwinischen Viehzüchter in der Gegend von Ak-Dowurak setzten ihre Öfen aus Ton und der `Wolle der Berge´, damit sie ewig halten mögen.
Bereits um die Jahrhundertwende interessierten sich englische, französische, polnische und russische Geschäftemacher für dieses Vorkommen. Die revolutionären Ereignisse in Russland, deren Atem auch das russische Protektorat in Zentralasien zu spüren bekam, und die Proklamation der selbständigen Volksrepublik Tannu-Tuwa war das Asbest-Vorkommen am Kara-Dasch in des tuwinischen Volkes Hand. Allerdings gehörte die Hand Viehzüchtern, die nicht einmal ihren Namen schreiben konnten.
Und so wandte sich die Revolutionäre Volkspartei Tannu-Tuwas hilfesuchend an die Sowjetunion. 1933 begann der sowjetische Betrieb `Sojusasbest´, der für die tuwinische Asbestförderung Zuarbeiten von zweihundert sowjetischen Betrieben koordinierte, den Bau einer Fabrik und einer Arbeitersiedlung. Nachdem in der Siedlung Ak-Dowurak 750 Menschen lebten und sowjetische Geologen das Vorkommen als überreich eingeschätzt hatten, übergab die Sowjetunion das Geschaffene 1934 in tuwinische Hände, die Fachkräfte für `Tuwaasbest´ jedoch kamen aus allen Gegenden der Sowjetunion. Es waren Vertreter von 31 sowjetischen Nationen und Völkerschaften, unter ihnen Russen, Belorussen, Armenier, Georgier, Chakassen, Mordwinen, Tschuwaschen, Udmurten, Baschkiren, Moldawier, Usbeken, Nanaier, Tabassaraner, Karatschaier, Tscherkessen, Komi-Permjaken.
Nicht alle blieben, die von überallher in diese klimatisch unwirtliche Gegend gekommen waren, denn die jährlichen durchschnittlichen Temperaturschwankungen betragen hier 98 Grad; die niedrigste durchschnittliche Januartemperatur liegt bei minus 60 Grad, die höchste durchschnittliche Julitemperatur bei plus 38 Grad.
Noch vor zwei Jahrzehnten lebten hier nur wenige Tuwiner, heute ist jeder fünfte ausgebildete Asebestarbeiter tuwinischer Nationalität.
Einer von ihnen heißt Nikolai Saryglar, Haupttechnologe in der Abteilung `Astbestaufbereitung´. Mit ihm fahren wir erst einmal zum Tagebau. Meinen Augen bietet sich dieser grau und unansehnlich dar. Noch Nikolai Saryglar schwärmt von dem aufgeschnittenen Berg; `Sehen Sie nur, wie das blitzt und funkelt.´ Er hat Glück, ein zaghafter Sonnenstrahl verschönt gerade rechtzeitig den gräulichen Anblick des dreieinhalb Kilometer breiten und 120 Meter tiefen unansehnlichen Tagebaus.
Wer Nikolai Saryglar reden hört, muss glauben, dass man ihm schon an der Wiege gesungen hat, einmal Spezialist für die Aufbereitung von Asbest zu werden. `Asbest´, so sagt er, `ist für einige Erzeugnisse noch heute nahezu unersetzlich. Ohne Asbest ist ein gewöhnliches elektrisches Bügeleisen heute noch genauso undenkbar wie eine kosmische Rakete. Da ist seine erstklassige Hitzebeständigkeit; er schmilzt erst bei über tausend Grad Celsius. Asbest hat ein hohe und gleichmäßige Reißfestigkeit; er steht hinter wertvollsten Stählen kaum zurück. Ferner sind unbedingt zu nennen seine beträchtliche Elastizität, seine Vibrations- und Alterungsbeständigkeit, seine Säure- und Laugenfestigkeit, seine sehr guten Filtereigenschaften und auch die Schalldämmung.´
Nikolai Saryglar hebt einen Stein auf, eben den, der nunmehr zu Haus in Berlin auf meinem Schreibtisch liegt, und und weist auf die Asbestschichten: `Asbest ist ein Paradoxon der Natur. Trotz seiner faserigen Konstitution und seines baumwoll- oder seidenartigen Aussehens ist er ein reines Mineral. Er ist das einzige Gestein, das faserig in Erscheinung tritt und sowohl mineralische als auch textilähnliche Eigenschaften besitzt. Wir kennen Asbest - der vulkanischen Ursprungs ist - vornehmlich in zwei Sorten, die sich nach dem Muttergestein unterscheiden, in dem er gefunden wird. Von grünlich-weißer Färbung mit Perlmuttglanz, das ist der Hornblendenasbest, sein Schmelzpunkt liegt bei 1 150 Grad. Der wertvollere jedoch ist der hier gefundene olivgrüne, Seiden glänzende Serpentinasbest, der bis zu 1 550 Grad Hitze verträgt.´ Im Tuwinischen hat man für Asbest die Bezeichnung `tag-tügü´, was zu deutsch Bergwolle heißt.
Nikolai Saryglar wurde 1954 in dem kleinen Dorf Bora-Taiga geboren, arbeitete nach der zehnten Klasse als Schafhirt. Als Soldat machte er an einem freien Tag mit einigen Kameraden einen Ausflug nach Kysyl, begegnete der schönen Aradilja, sie wurde seine Frau. Heute arbeiten beide im Förder- und Aufbereitungswerk `Tuwaasbest´ in Ak-Dowurak. Das hört sich ganz einfach an...
Asbest ist eine chemische Verbindung, die natürlich vorkommt und Magnesiumsilikat enthält. Asbest wurde als Schutzmaterial in Gebäuden, in der Autoindustrie, für Filteranlagen usw. verwendet. Der Asbeststaub, der bei der Verarbeitung entsteht, lagert sich in der Lunge ab und führt zu einer Lungenerkrankung (Asbestose), die evtl. eine bösartige Erkrankung nach sich zieht (Asbestkrebs, Pleuramesotheliom). - Inzwischen besteht ein vollständiges Verbot für Asbestverwendung. Auch in Tuwinien? (Ich konnte keine Angaben darüber finden.)
Vom Tagebau aus begleitet uns Nikolau Saryglar zur Schaltzentrale; auf dem Weg dorthin erfahren wir, dass es so einfach nun auch wieder nicht war. Als Nikolai Saryglar noch als Soldat diente, hatte seine Frau schon den Abschluss an der Polytechnischen Fachschule in Kysyl, sie war nun Fachmann für die Aufbereitung von Bodenschätzen. Und: Sie träumte von Ak-Dowurak, dem Ort, der einst aus wenigen Erdhütten und einigen Jurten bestand und nun ein große Stadt war. Aber vor allem reizte die junge Aradilja das Förder- und Aufbereitungswerk `Tuwaasbest, der `Erstgeborene´ der tuwinischen Industrie. Nikolai Saryglar aber hing an seinem Beruf. Er konnte sich nicht vorstellen, etwas anderes zu sein als ein Schäfer.
Machen wir es kurz, Aradilja schaffte es, ihren Mann für das unbrennbare Mineral zu entflammen; auch er ging auf die Polytechnische Fachschule, um Fachmann für die Aufbereitung von Bodenschätzen zu werden. Ein Jahr lang lebte er getrennt von seiner Frau - sie war schon nach Ak-Dowurak gefahren -, da kam Bescheid aus dem Werk, dass er die nächsten zweieinhalb Jahre in der betriebseigenen Fachschule weiterstudieren könne.
Inzwischen haben wir den siebenten Stock des Verwaltungsgebäudes erklommen, sind in der Schaltzentrale angelangt.
Alle Arbeiter im Aufbereitungswerk begegnen uns mit einem Mundschutz. Das gemahnt mich daran, darüber zu schreiben, dass in letzter Zeit viel Negatives über Asbest zu hören war: Man sprach und schrieb davon, dass er nicht nur ein Werkstoff, sondern auch ein Schadstoff sei. Dann nämlich, wenn feinste Fasern eingeatmet werden, die ein Leben lang in der Lunge bleiben. Schon 1936 wurde die sogenannte Asbestose in der Liste der Berufskrankheiten aufgenommen. Heute wird dem hoch begehrten Werkstoff ein neuer Schadstoffeffekt angelastet: Expertenberichten zufolge deuten Untersuchungen auf eine krebsauslösende Wirkung eingeatmeter Asbestfasern hin.
Leider wird Asbest in den nächsten Jahren vor allem in der Bauindustrie noch durch keinen gleichwertigen Baustoff ersetzt sein, obwohl national und international fieberhaft daran gearbeitet wird.
Die Stadt Ak-Dowurak ist mit 13 468 Einwohnern (2010) heute der drittgrößte Ort in der Autonomen russischen Republik Tuwa. Die Asbestmine bei Ak-Dowurak ist eine der größten Asbestminen der Welt, die im Tagebau betrieben wird und --- die Luft in der Stadt leider stark belastet.
Von der Schaltzentrale aus führt uns Nikolai Aryglar in die Kantine, wo wir bei einem Gläschen georgischen Tees über Vergangene und Zukünftiges plaudern. `Großmutter´, erzählt der Haupttechnologe, `hat uns viel davon berichtet, wie es früher gewesen ist. Über eines sprach sie besonders häufig, darüber, dass eine tuwinische Frau die `Chereetschok´ - die `Unnütze´ genannt wurde. Das hatte mit der buddhistischen Religion zu tun, bei der die Frau als eines der Weltübel gilt.´
Heute beobachte ich oftmals, dass die tuwinischen Frauen mehr als die Männer bemüht sind, sich weiterzubilden, traditionelle Geleise zu verlassen.
Überhaupt - die Sowjetfrauen. Sie stellen 53 Prozent der Gesamtbevölkerung, 60 Prozent haben einen Hochschul- oder Fachschulabschluss´, ihr Anteil unter den Wissenschaftlern beträgt 40 Prozent, unter den Ärzten 80 Prozent.
`Guck mal, hatte meine Moskauer Freundin Olga mir geraten, `wie viele Frauen in der Metro lesen und wie viele Männer.´
Ich tat es, aber siehe da, die Zahl war in etwa gleich. Allerdings: Die meisten Frauen lasen Bücher, die meisten Männer Zeitungen, vorrangig die `Sowjetski sport´. Olga übrigens hatte sich von ihrem Mann scheiden lassen, `weil es langweilig mit ihm war. Viele unserer Männer sind weniger gebildet, weniger geistig entwickelt als die Frauen; das lässt sich mit Zahlen einwandfrei beweisen. `Und´, so Olga zornesrot, `trotz des niedrigeren kulturellen Niveaus beanspruchen die meisten Männer aus Tradition noch immer die Vorherrschaft in der Familie.´
Nun hat Kysyl zwar keine Metro, aber auch hier stellen die Frauen weit mehr als die Hälfte der Theaterbesucher, und auch in den Museen, Ausstellungen, Bibliotheken sind sie weit in der Überzahl.
`In Kysyl´, sagt Marina, `sind die Dienstleistungsangebote ganz und gar unzureichend. Wenn sich da nicht bald etwas ändert, ist die Mehrbelastung der Frau im Haushalt und bei der Kindererziehung eindeutig ein Minus der Emanzipation.´
Das Problem ist landesweit erkannt. Abhilfe soll hier unter anderem das neue Gesetz über die individuelle Erwerbstätigkeit schaffen.
Die Besichtigung des Asbest-Tagebaus und die dann folgenden Gespräche haben uns doch so viel Zeit gekostet, dass wir schweren Herzens auf den Besuch von `Tuwakobalt´ verzichten müssen und auf die Informationen angewiesen sind, die uns die allwissende Marina gibt.
In den Bergen, über hundert Kilometer von Kysyl entfernt, liegt die Siedlung Chowu-Aksy. Hier leben die Arbeiter des Kombinats `Tuwakobalt´, das seit 1970 produziert. Das Kombinat gehört nicht zu den Riesenbetrieben der sowjetischen Nichteisenmetallurgie. Seine Erzeugnisse, Kobaltkonzentrat, Kupfer, Nickel Arsen, Quecksilber und Gold, müssen mit Lastwagen bis zur nächsten Bahnstation gefahren werden, das sind fast fünfhundert Kilometer. Auf dem gleichen langen Weg bezieht das Kombinat seine Ausrüstungen.
`Für die Sowjetunion als Ganzes ist die Rolle dieses Betriebes nicht so überwältigend´, erläutert Marina. `Verglichen mit dem riesigen Norilsker Bergbau- und Aufbereitungskombinat nördlich des Polarkreises, das die gleichen Erzeugnisse wie `Tuwakobalt´ auf den Markt bringt, nimmt sich unser Werk wie ein Kleinkind aus. Doch für Tuwinien, das noch vor vier Jahrzehnten überhaupt keine eigene moderne Industrie gekannt hatte, kann seine Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es kommt uns nicht einmal so sehr auf die Erzeugnisse an, die - jedenfalls bis jetzt - in Werken außerhalb unserer autonomen Republik Verwendung finden. Aber dieses Kombinat ist für uns zu einer Kaderschmiede geworden. Hier werden Bewohner unserer Republik, Kinder nomadisierender Viehzüchter, in Berufen ausgebildet, die sie vorher nicht gekannt haben. Sie lernen die Technik kennen, gewöhnen sich an Lenkung und Leitung der neuzeitlichen Produktion sowie an das Leben in einem multinationalen Kollektiv.´
Die Nacht verbringen wir in Ak-Dowurak, in einem `Prophylaktorium´. Als wir morgens nach Patienten und einem Arzt fahnden, erfahren wir, das dies ein sogenanntes Nachtsanatorium ist. Die Patienten werden vierundzwanzig Tage lang nach der Arbeit behandelt, schlafen im Sanatorium und gehen morgens zur Arbeit. Keiner ist mehr da, als wir aus den Federn kriechen.
Mitte der vierziger Jahre gab es in Tuwinien sechsundzwanzig Ärzte, gegenwärtig sind es etwa tausend. Marina erzählt uns, dass heute selbst die entlegensten Weideplätze der Rentierzüchter regelmäßig von Medizinern aufgesucht werden. In vielen hoch gelegenen Gegenden ist der Hubschrauber einziges Transportmittel. Eine Stunde Flugzeit kostet fast sechshundert Rubel. Die Reise dorthin und zurück dauert anderthalb Stunden. Ein dringender Krankenbesuch kostet somit - wenn man die Entlohnung des medizinischen Personals und die Bezahlung des Hubschraubers zusammenrechnet - mehr als zweitausend Rubel.
Ich finde es gut, von solchen Summen zu wissen, wenn man im Zusammenhang mit der Umgestaltung auch von vielen Versäumnissen und Fehlern innerhalb des Gesundheitswesens liest und hört. (...) "
Über Menschlichkeit (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Samagaltai war unsere letzte Ausfahrt über Land. Abends ist noch ein Besuch im Musikalisch-Dramatischen Theater in Kysyl vorgesehen, und morgen geht´s - wenn das Wetter ein Einsehen hat - zurück nach Hause.
Auf der Rückfahrt überdenke ich die beiden Ausflugstage...
Es hat mir imponiert zu hören, wie viele ehemals `Unnütze´ im Kreis Samagaltai Leitungsfunktionen ausüben. Serenmaa Kuular, Erster Sekretär des Kreisparteikomitees, ist ein Weib, auch der Verantwortliche für die gesamte landwirtschaftliche Bautätigkeit, auch der Leiter des Dienstleistungskombinats, auch der Bürgermeister des Dorfes Samagaltai, auch der Direktor der Mittelschule, auch der `Kulturzuständige´ des gesamten Kreises.
Es hat mich beeindruckt, welche großen Anstrengungen unternommen werden, um sich auf den Winter vorzubereiten. Allein die Beschaffung des Futters für 76 000 Schafe, 9 000 Rinder, 3 600 Yaks, 1 800 Pferde und 1 080 Kamele ist alle Jahre wieder ein große Problem; ausreichend Regen, wie schon berichtet, fiel hier seit fünfzehn Jahren nicht.
`Aber zusammen mit Serenmaa Kuular´, sagen die Leute, `schaffen wir das schon.´
Die verwitwet Serenmaa Kuular, Mutter zweier Töchter, lebt nach einem ganz strengen Tagesplan. Ihr Territorium ist 6 700 Quadratkilometer groß, davon sind 157 000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. 9 000 Menschen leben im Kreis Samagaltai, 8 700 davon Tuwiner. Serenmaa Kuular hat alle Hände voll zu tun. In den Schoß gefallen ist ihr die verantwortungsvolle Funktion nicht: 1953 hatte sie die Siebenklassenschule beendet (heute ist auch in Tuwinien überall die Zehnklassenschule obligatorisch), danach vier Jahre lang an der Parteihochschule in Moskau studiert; sie war Lehrer der Unterstufe, dann Lehrer für die höheren Klassen, wurde erst Dritter, dann Zweiter Sekretär des Kreisparteisekretärs und 1982 Erster Sekretär. Kurz nach ihrer Wahl starb ihr Mann. `Da wollte ich alles hinschmeißen´, sagt sie. `Aber die Genossen und die Leute im Dorf halfen mir über den Berg.´
Serenmaa Kuular ist sympathisch auf den ersten Blick, meist sehr ernst, kann aber auch so herzhaft lachen, dass ich mitunter mitlache, ohne zu verstehen, warum. Frauen, die so tapfer ihren Mann stehen, kann man überall in Tuwinien treffen.
Ich versuche, die zwei Tage, die wir kreuz und quer durch den Kreis Samagaltai fahren, vor allem zu nutzen, um den tuwinischen Alltag zu beobachten. Bemerkenswert für mich ist das Verhältnis der Erwachsenen zu den Kindern. Nach der nordkaukasischen Dagestanischen ASSR ist die zentralasiatische Tuwinische ASSR die Republik mit dem größten Kinderreichtum in der gesamten RSFSR. Bis etwa zum vierten Lebensjahr wird den Kindern hier alles nachgesehen, lässt man ihnen alles durchgehen, wird ihnen jeder Wunsch erfüllt. Das ganz Kleine wird gestillt, wann immer es schreit, festgelegte Zeiten gibt es nicht. Und es findet sich immer jemand - Familienmitglied oder Nachbar -, der es auch dann noch herumträgt, wenn unsereinen schon die Galle überlaufen würde.
Kinder kommen in Jurte oder Zimmer und gehen wieder, wann es ihnen gefällt, sitzen bei Gesprächen der Erwachsenen ganz selbstverständlich dabei, niemand verscheucht sie. Sie reden allerdings nur, wenn sie gefragt werden. Ich habe nicht ein einziges Mal gesehen, dass ein Kind angeschrien oder gar geschlagen wurde. Trotzige und eigensinnige Kinder sind mir dennoch nicht begegnet. Erklären kann ich mir das nicht, aber Marina vielleicht? Sie kann es auch nicht, bestätigt aber meine Beobachtungen. `Sie haben ganz richtig gesehen. Den Tuwinern sind Kinder - eigene und fremde - das höchste Gut.´
An diese Worte Marinas musste ich denken, als ich davon höre, dass im Oktober 1987 in der Sowjetunion ein Kinderfonds gegründet wurde.
Welche Tatsachen machten diesen Fonds zum Schutz der Kinder nötig?
In der Sowjetunion wird jede dritte Ehe geschieden, so dass jährlich etwa 700 000 Kinder Vater oder Mutter genommen wird. Die hohe Scheidungsquote ist nicht neu. Neu ist jedoch, dass so viele junge Frauen sich gleich im Entbindungsheim von ihren Kindern lossagen. Allein in Togliatti - um nur ein Beispiel zu nennen - werden jährlich etwa 3 000 Kinder in den Entbindungsheimen zur Adoption zurückgelassen. Albert Lichanow, Chefredakteur der Jugendzeitschrift `Smena´ und Präsident des Kinderfonds, kommentiert diesen Tatbestand mit harten Worten: `Dies ist der schreckliche Preis für die Schattenseiten einer Periode, die wir jetzt vorsichtig als Stagnation bezeichnen. Für den enormen Alkoholverbrauch nicht nur von Männern. Für die laxe gesellschaftliche Moral nicht nur im sexuellen, sondern im weitesten Sinne dieses Wortes. Für die Gleichgültigkeit in allen Lebensbereichen - von der Arbeitsstelle bis hin zur Familie. Für die Abwertung von Worten und Gefühlen. Für die Mängel im Gesundheitswesen. Für die schlechte ökonomische und gesetzgeberische Politik, wo für ergaunerte Rubel alles, für ehrliches Geld hingegen nichts zu haben war. Diese Aufzählung könnte man fortsetzen, und bei weitem nicht alles wird sich über Nacht ändern. Diese Krankheit ist nicht so leicht zu heilen...´
Anfang 1988 wurde in Moskau eine Kommission geschaffen, die die Fortschritte bei der Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft und die des Mannes am Kochtopf und bei der Kindererziehung untersucht. Die bei dieser Kommission als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigte Anastasija Possadskaja höre ich dann auch noch einen weiteren, sehr wichtigen Grund für das mir völlig unverständliche Zurücklassen der Neugeborenen. `Auch die jungen Russen´, sagt sie, `üben den Geschlechtsverkehr heute schon in jüngeren Jahren aus als früher, und auch bei ihnen bleibt dies nicht immer ohne Kinderfolgen. Oft wissen die jungen, häufig von den Männern allein gelassenen Mütter nicht, wohin mit sich und ihrem Kind. Viele Eltern sehen die voreheliche Schwangerschaft ihrer minderjährigen Tochter als Schande an und lassen sie zu Hause nicht wieder einziehen. Heime, die den Müttern Obdach geben - wie sie bei Ihnen in der DDR üblich sind -, gibt´s bei uns bis jetzt nicht.´ Das wirft auf diese erschütternde Tatsache doch schon an anderes Licht.
Solche Heime werden in Zukunft vom Kinderfonds eingerichtet und versorgt werden. Zu den unmittelbaren Aufgaben des Kinderfonds gehören außerdem die Förderung besonders begabter Kinder, der Kampf gegen Rauschgiftsucht, gegen Kriminalität und die Hilfe für Kinder, die in schwierigen Familienverhältnissen leben. Die wichtigste Aufgabe des Kinderfond ist, alle Kinderheime und die unter Vormundschaft stehenden Waisenkinder intensiv zu betreuen.
Bereits 1924 war ein Hilfsfonds für Kinder gegründet worden, der seine Tätigkeit 1938 leider einstellte.
Doch weiter Albert Lichanow: `Daher betrachten wir es als unsere Aufgabe, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft wieder auf die Kinder zu lenken. auf unsere eigenen Kinder. Auf die fremden Kinder. Auf alle Kinder. Bei all unseren Umgestaltungen - ob in Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie, Kultur und Kunst - müssen wir uns nicht zuletzt, sondern gleich am Anfang fragen: Was tun wir dabei für die Kinder?´ Der Fonds will den Menschen wieder beibringen, behutsam mit den Kindern umzugehen.
Welchen Menschen? Den Menschen tuwinischer Nationalität muss es - bis jetzt zumindest - keiner beibringen.
`Sie müssen aber nicht denken´, hatte Marina auch gesagt, `dass wir unseren Kindern keinerlei Aufgaben zumuten. Schon vom fünften Lebensjahr an haben sie ihre ganz regelmäßigen Pflichten.´
Vielleicht geht man mit den Kleinen in Tuwinien so überaus nachsichtig um, weil man weiß, dass schon sehr bald auch auf sie der Ernst des Lebens zukommen wird. So sah ich viele etwa Fünfjährige Brennmaterial sammeln, etwas ältere Kinder das Milchviel wegtreiben und abends dann wieder heimholen, zehnjährige Mädchen Teig zubereiten, kochen und melken. Dazu Marina: `Wichtig dabei ist, dass all dies keine gelegentlichen Hilfeleistungen der Kinder sind, sondern innerhalb der Familie feste Aufgaben. Man sagt, dass tuwinische Kinder mit zwölf Jahren alle wichtigen alltäglichen Aufgaben ganz selbständig verrichten können.´
Vielleicht nimmt man die Kinder so ernst, weil man sie - auf Grund ihrer alltäglichen Pflichten - als kleine Erwachsene betrachtet?
Viele Tuwiner nannten, wenn ich sie nach ihren Kindern fragte, auch ihre Neffen und Nichten. Anfangs hatte ich dies nicht beachtet, doch als auch Serenmaa Kuular von ihren beiden Töchtern und ihrem Neffen sprach, fragte ich sie, warum denn ihr Neffe bei ihr lebe? Und wieder erfahre ich von einer tuwinischen Besonderheit: Braucht jemand aus der Verwandtschaft Hilfe - wie Serenmaa Kuular, als ihr Mann gestorben war -, so schickt man, sofern man mehrere Kinder hat, das Kind passenden Alters zu ihm. Der Neffe, der jetzt bei ihr `wie das eigene Kind lebt´, war damals zwölf Jahre alt. `Meine Kinder - deine Kinder, eigene Kinder - fremde Kinder, das gibt es in Tuwinien nicht´, behauptet Marina. Und: `Es ist auch ganz selbstverständlich, dass Kinder von Verwandten aufgenommen werden, wenn sie an dem Ort studieren oder lernen wollen, wo man selbst wohnt.´
Ich scherze: `Dann müssten ja fast alle Kysyler Einquartierung haben.` Marina nickt: `So ist es.´
Sieben Monate nach Gründung des Kinderfonds lese ich in der `Ekonomitscheskaja gaseta´, dass auch Menschen nichttuwinischer Nationalität ihr Herz für die Kinder durchaus bewahrt haben, denn innerhalb dieser Zeit waren 180 Millionen Rubel auf das Konto des Kinderfonds eingezahlt worden.
Da ich mich davor hüten will, auf Grund einiger Beobachtungen gleich zu verallgemeinern, frage ich wiederum Marina, ob es stimmt, dass die Eltern in Tuwinien, sofern sie krank, schwach, eben hilfsbedürftig geworden sind, zu den Kindern ziehen. `Ja´, antwortet sie, `grundsätzlich.´
Und Marina, meine liebe Marina, die mir im für mich fremden Land sehen und hören hilft, fügt hinzu: `Sie hatten vielleicht keine Gelegenheit zu sehen, dass nicht nur Kinder und alte Menschen ganz selbstverständlich in Familien leben, sondern auch Menschen mit Gebrechen, seien sie körperlicher oder geistiger Art. Man achtet die Behinderten als Menschen, niemand schämt sich ihrer.´
Wie schon so oft auf meinen Reisen in die Sowjetunion, besonders auf denen zu den kleinen Völkern, stimmen mich viele ihrer barmherzigen Sitten und Bräuche nachdenklich.
Sehr nachdenklich."

Serenmaa Kuular, die in Samagaltai "ihren Mann steht".
Foto: Detlev Steinberg
Wir groß wird Geld geschrieben? (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Auf unserer Rückfahrt von Samagaltai nach Kysyl hatten wir einen Fünfzig-Kilometer-Umweg in die Steppe gemacht, damit sich mein Wunsch doch noch erfüllt, Kamelen, richtigen Kamelen, Auge in Auge gegenüberzustehen.
1965 zählte man in der gesamten Sowjetunion 280 000 Kamele, zehn Jahre später hatte sich ihr Bestand auf 253 000 verringert. Wozu, dachte man wohl, braucht das 20. Jahrhundert noch das Kamel? Wozu? das Kamel, eines der am frühesten vom Menschen gezähmten Tiere - Last-, Zug- und Reittier -, hat außerordentlich kalorienreiches Fleisch und gibt Milch - eine Mutter bis zu zehn Liter täglich -, Wolle und Leder. In Tuwinien weiß man das Kamel bis auf den heutigen Tag durchaus zu schätzen, vorrangig als Transporttier: Im Winter bringt es die Besitzer zuverlässig im Schlitten von Ort zu Ort, oft sieht man dann sogar in Kysyl Reiter auf ihren Kamelen. In vier Sowchosen Tuwiniens werden Kamele gezüchtet. Samagaltai ist einer von ihnen.
`Unsere´ 183 Kamele gehören dem auf Pferde (1 400 an der Zahl) und Kamele spezialisierten Sowchos `Tschogusun´, sie grasen mitten in der Steppe am Fluss Tess, `der so rein ist, dass es hier keine Fiche gibt, sie fänden keine Nahrung´. Solch von mir noch nie Gehörtes behauptet jedenfalls Roman Aldyn-Cherel, der junge, hierzulande aber schon berühmte Kamelhirt. Es ist beeindruckend, mit anzusehen, wie er die großen Tiere sanft seinem Willen unterordnet. Er trägt den landesüblichen Tonn, lila-rot, schon dick wattiert, denn im September gibt es hier bereits zwei Wochen lang zwei bis drei Minusgrade. Roman Aldyn-Cherels Kamele fressen gerne Sedum und Teufelspfeilgras, am meisten mögen sie jedoch Disteln, die meinen Strumpfhosen zum Verhängnis werden.
Eigentlich bin ich schon überglücklich, die majestätischen Kamele in der freien Natur gestreichelt und beguckt zu haben, doch da wartet etwa zwanzig Kilometer weiter noch eine Überraschung auf uns: `Sie hatten doch´, sagt Serenmaa Kuular, die es sich nicht nehmen lässt, uns durch ihren Bezirk das Autogeleit zu geben, `so gern einen tuwinischen Ringkampf sehen wollen. Seien Sie ehrlich, sie dachten, wir hätten das vergessen...?´ Ehrlich: Nachdem ich während der drei Tage unseres Besuches in Samagaltai immer und immer wieder daran erinnert hatte, ohne dass - wie mir schien - das Geringste geschah, hatte ich alle Ringkampfträume aufgegeben...
Und da erwartet uns mitten in der Steppe der Trainer Anai-ool Sajanowitsch, der mit sechs seiner Mannen (von Beruf zwei Kraftfahrer, zwei Schüler, ein Schlosser und ein Kfz-Schlosser) erschienen ist, um uns den tuwinischen Ringkampf vorzuführen, `so oft es uns gefällt´. Die Kämpfer geraten ganz schön in Schweiß. Als besiegt gilt derjenige, der den Boden berührt. Der Sieger klopft sich dann auf die Schenkel, reicht dem Besiegten die Hand und: tanzt selbstvergessen und glücklich den sogenannten Adlertanz.


Der tuwinische Ringkampf "Churesch", den ein Adlertanz des Gewinners krönt.
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
Zu sagen wäre noch, dass man uns inmitten von Kollerdisteln einen Abschiedsschmaus aufgebaut hat, der wegen der Fülle der Speisen und Getränke und der beschränkten Seitenzahl dieses Buches leider unbeschrieben bleiben muss.
In einer Mittelschule in Samagaltai hatte ich wegen des meiner Meinung nach zu hohen Taschengeldes unserer deutschen Kinder auf dem Schulhof Dreizehn- bis Vierzehnjährige gefragt, wie viel Geld sie bei sich haben. Abgesehen von ein paar Kopeken, die in der einen oder anderen Hosentasche klimperten, hatte niemand auch nur einen Rubel bei sich. Nun gut, sagt ich mir, in einem Dorf...
In Kysyl wiederholte ich meine Frage, stellte sie den aus der Schule eilenden Schüler der achten bis zehnten Klasse. Die erste Antwort - Verlegenheit. Die zweite - stotternd vorgebrachte Kleinstbeträge. Ich war der Sache damals nicht weiter nachgegangen, obwohl ich mich über die Anspruchslosigkeit der jungen Leute in Tuwinien gewundert - und sie bewundert hatte. Damals wusste ich noch nicht, dass in Tuwinien Geld in den Händen von Kindern als Tabu-Thema gilt und sie deshalb nicht aufrichtig zu mir waren..."
Dersu Usala, der Tuwiner (LESEPROBE aus: "Von der Wolga bis zum Pazifik")
"Ich bin neugierig, wie man sich kleidet, wenn man in Kysyl ins Theater geht. An den Männern ist nichts Besonderes zu entdecken, sie haben alle ihren (oder einen) guten Anzug an. Bei den Frauen ist es schon anders... Viele tragen lange Kleider im Schnitt der tuwinischen Nationaltracht, des Tonn; die Kleider sind aus schwerer Seide oder aus Brokat, der rechtsseitige Verschluss mit Goldborte betont. Die Stoffe sind einfarbig grell oder großgeblümt. Auch die Frauen in europäischer Kleidung haben sich ausgesprochen fein gemacht.
Schon an der Spannung im Zuschauerraum spürt man: Für die, die hier mit größeren oder ganz kleinen Kindern Platz genommen haben, ist ein Theaterbesuch nichts Alltägliches. Die heutige Vorstellung, ein sogenanntes theatralisiertes Konzert mit Tänzen, Liedern und szenischen Darstellungen, findet für Hirten und Viehzüchter statt. Man singt und tanzt, Asiatisches und Europäisches, Gegenwärtiges und Vergangenes; den feurigen so anziehend-abstoßenden Schamanentanz werde ich so bald nicht vergessen.
Kürzlich schenkte mir mein Freund Matthias aus Berlin (West) - wir hatten uns vor einigen Jahren im Haus der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur kennengelernt - das Buch `Schamanengeschichten aus Sibirien´. Matthias ist Metallarbeiter, und die sowjetischen Menschen und das sowjetische Land waren schon sein Hobby, als `drüben´ beides noch nicht `in´ war...
Das Buch ist ein wahre Fundgrube. Erst jetzt erfahre ich, dass das Wort Schamane aus dem ostsibirischen Raum kommt, einem Gebiet, in dem der Schamanimus am stärkten ausgeprägt war und wo vielleicht sein Ursprung liegt. Übersetzt heißt Schamane soviel wie sich anheizen, verbrennen, mit Hitze und Feuer arbeiten. In diesen Ausdrücken finden wir auch das wesentlichste Merkmal eines Schamanen. `Er ist Meister der Energie, des Feuers als Medium der Verwandlung. Er erkennt, dass alles Leben der Erde hinter dem materiellen Gewand ein energetisches trägt, mit dem es im wechselseitigen Austausch mit der Anderen Welt, der unsichtbaren, der geistigen Welt, in Verbindung steht.´ An den Begriffen Energie, Hitze, Feuer, Brennen spiegelt sich die Erfahrung eines Schamanen wider, die er tatsächlich erlebt, wenn er in der Anderen Welt weilt und dort den Geistern, Göttern oder dem Höchsten Wesen begegnet. Die charakteristische Fähigkeit des Schamanen ist sein scheinbar wirklicher Zugang und Kontakt mit den Wesen der Anderen Welt, mit den Wesen des Himmels. Mit Schamanismus wird ein ekstatisches Priestertum bezeichnet, das sich bei nahezu allen Naturvölkern der Erde in Ansätzen oder reicherer Ausbildung findet, unter den sibirischen Volksstämmen, wozu ja auch die Tuwiner zählen, aber seine eindrucksvollste Entfaltung gefunden hat. Vom Ochotskischen Meer bis nach Lappland und von der Eismeerküste bis zu den hochasiatischen Gebirgszügen hat der Schamanismus das geistige Gesicht der Völker mitgeprägt.
Ich bin noch ganz benommen von der Exotik des Schamanentanzes auf der Bühne, als plötzlich - selbst in schwarzem Anzug unverwechselbar - Dersu Usala, der Taigajäger aus dem gleichnamigen japanisch-sowjetischen Film, der in Moskau den `Großen Preis´ und in Hollwood einen `Oskar´ errang, auf der Bühne steht.
Mein Blick gleitet immer wieder an dem kleinen, muskulösen Mann herunter, ist er´s oder ist er´s nicht? Er singt zusammen mit einer Frau (`mit einer Frau´, flüstert mir Marina zu) alttuwinische Lieder. Sie müssen sehr lustig sein, denn da Publikum lacht und lacht.
Ich erinnere mich genau, all Unterlagen den Darsteller von Dersu Usala betreffend, in meinem `Völkerschafts-Archiv´ unter Baschkiren abgelegt zu haben; denn in unserer Presse hieß es damals, als der Film in der DDR lief, dass Maxim Munsuk ein Schauspieler aus Ufa sei.
Aber diese Ähnlichkeit...
Und dann ein ganz besonderer Blick von Maxim Munuk ins Publikum, treuherzig würde ich ihn nennen, da weiß ich: Der etwa Siebzigjährige dort oben auf der Bühne ist der Held eines meiner Lieblingsfilme!
Kennen Sie Maxim Munsuk? Sagen Sie nicht glich nein, denn wenn Sie den Film `Dersu Usala´ sahen, ist er Ihnen als der Hauptdarsteller bestimmt so nahegekommen, dass Sie ihn bis auf den heutigen Tag in Erinnerung behielten. Die Überraschung für mich: Maxim Munsuk, der Darsteller des Dersu Usala, ist Tuwiner.
Und wer war Deru Usala?
Ein Jäger in der Ussuri-Taiga, der durch eine Pockenepidemie all seine Angehörigen verloren hatte und nun mutterseelenallein, ganz eins mit der wilden Natur und den wilden Tieren, lebte. Dersu Usala aus dem Stamm der Golden (die sich heute Nanaier nennen) war ein unübertroffener Fährtenleser, schoss so treffsicher, dass Berufsschützen der Atem wegblieb, und war vertraut mit den Sitten und Bräuchen der Einheimischen; er wusste die Tücken der Taiga zu meiden und ihre Gaben zu nutzen. In die Literatur eingegangen ist der Taigajäger durch den Russen Wladimir Arsenjew (1872 bis 1930), der dem herzensguten nanaiischen Menschen Dersu in seinem Buch ein Denkmal setzte.
Und wer war Wladimir Arsenjew?
Ein Topograph, Völkerkundler, Biologe und Zoologe aus Petersburg, der im Auftrag der Russischen Geographischen Gesellschaft um die Jahrhundertwende mehrere Expeditionen durch noch weitgehend unerschlossene Gebiete führte, um sie kartographisch zu erfassen. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten über die fernöstlichen Landschaften veröffentlichte er Anfang der zwanziger Jahre sein Buch `Dersu Usala´, das einen begeisterten Leserkreis fand. Maxim Gorki schrieb damals an Arsenjew: `Ich habe Ihr Buch mit dem größten Vergnügen gelesen und bin begeistert und bezaubert von der Kraft der Darstellung, ganz zu schweigen davon, dass sein Wert für die Wissenschaft unbestritten und bedeutend ist. Sie haben es verstanden, eine Synthese zwischen Alfred Brehm und James Fenimore Cooper zu finden - und das ist, glauben Sie mir, kein schlechtes Lob. Den Golden haben Sie ganz hervorragend geschildert, für mich ist diese Gestalt lebendiger als die des `Pfadfinders´...´
Dreißig Jahre lang hatte sich der japanische Regisseur Akira Kurosawa (weltberühmt geworden durch die Filme `Die sieben Samurai´ und `Rashoman´) mit dem Gedanken beschäftigt, die autobiographischen Aufzeichnungen Wladimir Arsenjew zu verfilmen. 1973 schlug `Mosfilm´ ihm - der in Japan keinen Produzenten zu finden vermochte - eine Koproduktion vor.
Akira Kurosawa sah nur einen Schauspieler als geeignet an, den von Arsenjew fotografierten und genau beschriebenen Dersu Usala zu spielen: den Japaner Tosiro Mifunie. Doch dem war es, anderer Verpflichtungen wegen, nicht möglich, über einen längeren Zeitraum in der Sowjetunion zu drehen. Man beschloss also, einen geeigneten sowjetischen Schauspieler - mit asiatischem Gesichtstyp - ausfindig zu machen. Lange suchte man unter Udehen, Nanaiern, Kirgisen, Burjaten, Baschkiren, Kasachen, Tuwinern...
Nach vielen Probeaufnahmen mit vielen Kandidaten war man überzeugt, in Maxim Munsuk den Dersu Usala gefunden zu haben. Wladimir Wassiljew, der sowjetische Co-Regisseur, hat über das Zustandekommen des Films Tagebuch geführt. Er beschreibt darin den Fleiß, die Ausdauer, die Besessenheit und nicht zuletzt die sibirische Urwüchsigkeit Maxim Munsuks. Da gibt es folgende, einem wahren Ereignis nachgestaltete Szene in Buch und Film: Die Überquerung eines reißenden Flusses. Alle Expeditionsteilnehmer sind schon ans Ufer gesprungen, nur Arsenjew und Dersu Usala befinden sich noch auf dem Floß, als es sich schon ganz in der Nähe eines furchtbaren Strudels befindet. Dersu Usala gibt Arsenjew gerade noch rechtzeitig einen Stoß, so dass der ans Ufer schwimmen kann, er selbst aber scheint dem sicheren Untergang geweiht. Im allerletzten Augenblick jedoch kann er sich durch einen gewagten Sprung an einen aus dem Wasser herausragenden Ast eines angeschwemmten Baumes klammern.
An dem Tag, als diese Szene gedreht werden sollte, bemerkte Maxim Munsuk plötzlich einen weiteren Mann in seinem Kostüm, dem Kostüm des Dersu Usala.
Wladimir Wassiljew beschreibt den Dialog mit Maxim Munsuk in seinem inzwischen als Buch erschienenen Tagebuch so: `Wer ist das´, fragte Maxim Munsuk ganz verstört. - `Das ist Ihr Double´, antwortete ich, `er wird statt Ihrer vom Floß aus auf den Ast des versunkenen Baumes springen.´- `Aber warum denn´, fragte Munsuk verständnislos. - `Maxim Maximowitsch´, redete ich ihm zu, `wir sind um Ihre Gesundheit besorgt. Das Wasser im Fluss ist schon eiskalt. Außerdem ist diese Aufnahme lebensgefährlich. Wenn Sie beim Sprung den Ast verfehlen und unter das Floß geraten, kann die Strömung Sie zu den Stromschnellen tragen. Und Sie können doch auch gar nicht schwimmen! Wie wollen Sie diese Szene bewältigen?´- `Also hören Sie, Wladimir Nikolajewitsch´, empörte sich Munsuk, `ich brauche kein Double. Was im Drehbuch vorgeschrieben ist, führe ich allein aus. Bei dem richtigen Dersu war das Wasser auch kalt, die Situation auch lebensgefährlich, und schwimmen konnte er auch nicht.´
Es blieb nichts weiter übrig, schreibt Wladimir Wassiljew weiter, als Maxim Munsuk auch diese Szene spielen zu lassen. Zwei Tage lang sei der Arbeitsplatz Maxim Munsuks das Floß gewesen in der Mitte des reißenden Flusses Awwakumoke, und stundenlang habe er im Wasser zugebracht, sich an den Ast des angeschwemmten Baumes klammernd. Mitunter sei von der Mitte des Flusses die heisere Stimme Maxim Munsuks erschollen: `Nun dreht doch endlich!´- `Aber´, schreibt der Russe Wladimir Wassiljew, `wir konnten und konnten diese Einstellung nicht drehen. Mal schien die Sonne uns direkt in die Kamera, dann wieder schien sie überhaupt nicht, oder die Strömung benahm sich nicht drehbuchgerecht, oder ein Sturzregen setzte ein oder ein Gewitter... An beiden Tagen im und auf dem Wasser äußerte Maxim Munsuk nicht ein einziges Mal Unwillen. Wir alle bewunderten ihn, den tapferen sechzigjährigen Tuwiner.´
Die Gestaltung des Golden Dersu Usala durch Maxim Munsuk hat mich begeistert und bezaubert - einer der Filme - 1976 ausgezeichnet mit einem Oscar -, die ich nicht vergessen werde. Gleichermaßen gelingt es ihm, innige Freude zu spielen (als ihm nach Jahren Wladimir Arsenjew in der Taiga wiederbegegnet), wie untröstlichen Kummer (als er, allein am Lagerfeuer, seiner toten Familie gedenkt), wie tiefe Verzweiflung (als er feststellen muss, dass seine Augen so schlecht geworden sind, dass seine Schüsse plötzlich ihr Ziel verfehlen), wie tiefempfundene Dankbarkeit (als Arsenjew den für die Gefahren der Taiga zu alt gewordenen Dersu zu sich in seine Stadtwohnung mitnimmt), die zermürbende Sehnsucht nach der Taiga (als er erkennt, dass er sich an ein Leben in der Stadt nicht gewöhnen kann)...
Marina hat meine Unruhe längst bemerkt, sie sitzt schon auf dem Sprung, ich muss sie gar nicht bitten, Maxim Munsuk nach der Vorstellung für uns festzuhalten.
Als er uns dann gegenübersitzt, würde ich ihn, auch im Straßenanzug, eher für einen wieselflinken Taigajäger als für einen Schauspieler halten.
Maxim Munsuk wurde 1912 geboren. Munsuk war, wie bei den Tuwinern üblich, sein einziger Name. Erst 1947 passte man sich den in der Sowjetunion üblichen Gepflogenheiten an. Zur Regel wurde, den tuwinischen Namen als Nachnamen zu wählen und einen Vornamen anzunehmen. Munsuk, der gleich nach Einführung der Schriftsprache 1930 - als Achtzehnjähriger also - lesen und schreiben gelernt hatte, entschied sich für den Vornamen Gorkis.
`Ich habe viele Entwicklungsetappen Tuwiniens selbst miterlebt. Als die Mandschuren die Oberherrschaft über uns hatten, war ich noch zu klein, aber dass wir russisches Protektorat waren, daran erinnere ich mich schon deshalb, weil ich von klein auf mit russischen Kindern Kontakt hatte. Die meisten Russen waren ihren Herrn davongelaufen, besaßen nicht viel mehr als wir. Als Tuwa Volksrepublik wurde, da jubelte ich, weil meine Eltern jubelten.´
Ende der zwanziger Jahre erlebte Maxim Munsuk in Kysyl einen Auftritt russischer Laienkünstler. Seitdem stand sein Beruf für ihn fest. `Von da an war ich im `Russischen Klub´ wie zu Hause.´ 1935 heiratete er Kara-kys, die von der Schauspielerei bald schon so begeistert war wie er. Anfang der dreißiger Jahre gründeten sie ein Laienensemble. `Mein Wunsch, in Moskau zu studieren´, sagt Maxim Munsuk, `erfüllte sich nicht, ich wurde wegen Mangel an Begabung abgelehnt. Nach 1944 kamen ausgebildete sowjetische Schauspieler nach Kysyl. Sie zeigten uns, `wie man´s macht´. Meine Frau und ich, wir gründeten dann ein Theater und studierten die Schauspielkunst in Kysyl.´
Die Munsuks haben fünf Kinder, drei Söhne und zwei Töchter, `auf die wir sehr stolz sind. Einer wurde Pilot, einer Ingenieur, einer Bühnenbildner; eine Fernsehregiseurin, eine Schauspielerin.´
Während unserer kurzen Begegnung wechseln in Maxim Munsuks Gesicht blitzschnell Freude und Trauer, Kummer und Zufriedenheit... Man könnte glauben, er betrachte das Leben als Bühne und vergäße einfach nie das Schauspielern. Man kann aber auch dem japanischen Regisseur Akira Kurosawa Glauben schenken, der über Maxim Munsuk sagte: `Er hatte es schwer, der Bühnenschauspieler, so fast ohne Filmerfahrung, und er hatte es leicht zugleich, denn er brauchte nur sich selbst zu spielen.´
Maxim Munsuk war unsere letzte tuwinische Begegnung. Morgen geht´s zurück nach Hause- wenn das Wetter ein Einsehen hat.
Es hat keines. Drei Tage lang narrt es uns. Drei Tage lang haben wir auf dem Flughafen Zeit, darüber nachzudenken, wie abgelegen das Land der Tuwiner ist - wegen der hohen, oft von Nebelschwaden verhüllten Gebirgsketten des Sajan."

Der Tuwiner Maxim Munsuk, als nanaischer Taigajäger in dem Film
"Dersu Usala" (links), und Juri Solomin als der russische Forscher Arsenjew.
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv
"Tuwa ist ein Land von unbeschreiblicher Schönheit,
ein spezielles Stückchen Natur."
Hansueli Müler, Sibirien-Reisen, Schweiz
Rezensionen und Literaturhinweise (Auswahl) zu den TUWINERN:
Rezension in meiner Webseite www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE BELLETRISTIK: Wladimir Arsenjew, Der Taigajäger Dersu Usala, Aus dem Russischen von Gisela Churs, Unionsverlag, Zürich 2003.
"Heute erinnern an Arsenjews Forschungen geografische Bezeichnungen wie Arsenjew-Vulkan auf den Kurilen-Inseln und Arsenjew-Gletscher auf Kamtschatka. Und an der Stelle, wo Arsenjew einst mit Dersu Usala zusammentraf, steht heute die fernöstliche Stadt Arsenjew."
In: www.reller-rezensionen.de
* KATEGORIE REISELITERATUR/BILDBÄNDE: Bodo Thöns, Sibirien entdecken, Trescher Verlag, Berlin 2001.
"`Sibirien entdecken´ von Bodo Thöns reiht sich - trotz der schon bekrittelten Kleinigkeiten, denen noch einige folgen werden - sehr würdig in meine den Verlag betreffende Positivbilanz ein. Thöns studierte nach dem Abitur Wirtschaftswissenschaften, schlug zunächst die akademische Laufbahn ein, erhielt zwei Doktorhüte und war von 1993 bis 1998 in Russland für die Commerzbank tätig. Das gab ihm die Möglichkeit, sowohl beruflich als auch privat viel im Lande herumzukommen. Vor allem, so lesen wir, reizte ihn die Gegend jenseits des Ural: Sibirien, das schlafende Land, so die wörtliche Übersetzung Sibiriens (SibIr) aus dem Tatarischen."
In: www.reller-rezensionen.de
*KATEGORIE BELLETRISTIK: Galsan Tschinag, Die neun Träume des Dschingis Khan, Insel Verlag, Frankfurt/Main und Leipzig 2007.
"Galsan Tschinag ist Stammes-Oberhaupt der mongolischen turksprachigen Tuwa, die verwandt sind mit den westsibirischen Tuwinern. 1996 erfüllte er sich seinen Lebenstraum, zur Rettung der alten Stammeskultur der Tuwa beizutragen. In dreiundsechzig Tagen führte er Teile des Volkes der Tuwa, die im Zuge kommunistischer Planwirtschaft im Norden der Mongolei angesiedelt worden waren, in einer riesigen Karawane mit einhundertdreißig schwer beladenen Kamelen, mit Schafen, Hühnern, Hunden und dreihundert Pferden über fast zweitausend Kilometer zurück in ihre ursprüngliche Heimat, in das Altai-Gebirge. Diese größte Karawane seit Dschingis-Khan erregte großes Aufsehen in der Öffentlichkeit und stärkte das Selbstbewusstsein der jahrzehntelang entwurzelten und unterdrückten tuwinischen Nomaden."
In: www.reller-rezensionen.de
Literaturhinweise (Auswahl)
* Egon Richter, Im Land der weißen Kamele, Reisereportage, Chronik einer Stippvisite, Mit Illustrationen von Inge Jastram, Hinstorff Verlag, Rostock 1986.
"Als der junge mongolische Stammesfürst Temudshin sich anschickte, die Welt zu erobern und sich alles zu unterwerfen, was unter die Hufe seiner Reiterheere geriet, handelte er nach dem Wahlspruch: Im Himmel Gott - und auf Erden Dschingis-Khan! Die erste fremde Erde, über die seine berittenen Scharen den Wege gen Westen antraten, war das Land Tuwa. Es war ein blühendes Land voller Kanäle und Wasserleitungen und Schmelzöfen, reicher Siedlungen und wohlhabender Bürger. Als der Sturm vorüber war, blieb eine Wüste zurück. (...) Die tibetanisch-mongolische Spielart des Buddhismus hielt Einzug, und die gelbmützigen Lamas gründeten Klöster in einem Land, das sich in eine Heimstatt armseliger viehzüchtender Wanderhirten, der Araten, verwandelt hatte."
* Saltschak Toka, Das Wort des Arat, Deutsch von G. Tanewa, Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin 1951.
Das ist eine autobiographische Erzählung über die Kindheit und Jugend des Autor, der vom ärmlichen Leben der tuwinischen Nomaden-Viehzüchter, Araten genannt, erzählt. Dieses Buch berichtet vom vorrevolutionären Leben der Tuwiner.
* Galsan Tschinag, Eine tuwinische Geschichte und andere Erzählungen, Mit einem Nachwort von Erwin Strittmatter, Verlag Volk und Welt, Berlin 1981.
* Tuwinische Volksmärchen, Übersetzt und herausgegeben von Erika Taube, Akademie-Verlag, Berlin 1978.
Mit dieser Sammlung werden zum ersten Mal einem deutschsprachigen Leserkreis Märchen der Tuwiner bekannt gemacht. Eine besondere Rolle spielen bei den tuwinischen Märchen die Reckenmärchen, die für die alttürkischen und mongolischen Völker charakteristisch und auf der Grenze zwischen Märchen und Heldenepos angesiedelt sind.
"Tuwa ist das Paradies."
Der Tagesspiegel vom 8. Oktober 2003
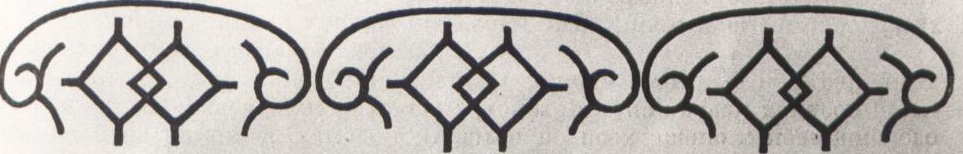
Bibliographie zu Gisela Reller
Bücher als Autorin:
Länderbücher:
* Zwischen Weißem Meer und Baikalsee, Bei den Burjaten, Adygen und Kareliern, Verlag Neues Leben, Berlin 1981, mit Fotos von Heinz Krüger und Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring.
* Diesseits und jenseits des Polarkreises, bei den Südosseten, Karakalpaken, Tschuktschen und asiatischen Eskimos, Verlag Neues Leben, Berlin 1985, mit Fotos von Heinz Krüger und Detlev Steinberg und Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring.
* Von der Wolga bis zum Pazifik, bei Tuwinern, Kalmyken, Niwchen und Oroken, Verlag der Nation, Berlin 1990, 236 Seiten mit Fotos von Detlev Steinberg und Zeichnungen von Karl-Heinz Döhring.
Biographie:
* Pater Maksimylian Kolbe, Guardian von Niepokalanów und Auschwitzhäftling Nr. 16 670, Union Verlag, Berlin 1984, 2. Auflage.
... als Herausgeberin:
Sprichwörterbücher:
* Aus Tränen baut man keinen Turm, ein kaukasischer Spruchbeutel, Weisheiten der Adygen, Dagestaner und Osseten, Eulenspiegel Verlag Berlin in zwei Auflagen (1983 und 1985), von mir übersetzt und herausgegeben, illustriert von Wolfgang Würfel.
* Dein Freund ist dein Spiegel, ein Sprichwörter-Büchlein mit 111 Sprichwörtern der Adygen, Dagestaner Kalmyken, Karakalpaken, Karelier, Osseten, Tschuktschen und Tuwiner, von mir gesammelt und zusammengestellt, mit einer Vorbemerkung und ethnographischen Zwischentexten versehen, die Illustrationen stammen von Karl Fischer, die Gestaltung von Horst Wustrau, Herausgeber ist die Redaktion FREIE WELT, Berlin 1986.
* Liebe auf Russisch, ein in Leder gebundenes Mini-Bändchen im Schuber mit Sprichwörtern zum Thema „Liebe“, Buchverlag Der Morgen, Berlin 1990, von mir (nach einer Interlinearübersetzung von Gertraud Ettrich) in Sprichwortform gebracht, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen, illustriert von Annette Fritzsch.
Aphorismenbuch:
* 666 und sex mal Liebe, Auserlesenes, 2. Auflage, Mitteldeutscher Verlag Halle/Leipzig, 200 Seiten mit Vignetten und Illustrationen von Egbert Herfurth.
... als Mitautorin:
Kinderbücher:
* Warum? Weshalb? Wieso?, Ein Frage-und-Antwort-Buch für Kinder, Band 1 bis 5, Herausgegeben von Carola Hendel, reich illustriert, Verlag Junge Welt, Berlin 1981 -1989.
Sachbuch:
* Die Stunde Null, Tatsachenberichte über tapfere Menschen in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges, Hrsg. Ursula Höntsch, Verlag der Nation 1966.
* Kuratorium zur kulturellen Unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland e. V., Herausgegeben von Leonhard Kossuth unter Mitarbeit von Gotthard Neumann, Nora Verlag 2008.
... als Verantwortliche Redakteurin
* Leben mit der Erinnerung, Jüdische Geschichte in Prenzlauer Berg, Edition Hentrich, Berlin 1997, mit zahlreichen Illustrationen.
* HANDSCHLAG, Vierteljahreszeitung für deutsche Minderheiten im Ausland, Herausgegeben vom Kuratorium zur kulturellen Unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland e. V., Berlin 1991 - 1993.

Die erste Ausgabe von HANDSCHLAG liegt vor. Von links: Dr. Gotthard Neumann, Leonhard Kossuth (Präsident), Horst Wustrau (Gestalter von HANDSCHLAG), Gisela Reller, Dr. Erika Voigt
(Mitarbeiter des Kuratoriums zur kulturellen Unterstützung deutscher Minderheiten im Ausland e. V.).
Foto aus: Rellers Völkerschafts-Archiv

Pressezitate (Auswahl)
zu Gisela Rellers Buchveröffentlichungen:
Dieter Wende in der „Wochenpost“ Nr. 15/1985:
„Es ist schon eigenartig, wenn man in der Wüste Kysyl-Kum von einem Kamelzüchter gefragt wird: `Kennen Sie Gisela Reller?´ Es ist schwer, dieser Autorin in entlegenen sowjetischen Regionen zuvorzukommen. Diesmal nun legt sie mit ihrem Buch Von der Wolga bis zum Pazifik Berichte aus Kalmykien, Tuwa und von der Insel Sachalin vor. Liebevolle und sehr detailgetreue Berichte auch vom Schicksal kleiner Völker. Die ethnografisch erfahrene Journalistin serviert Besonderes. Ihre Erzählungen vermitteln auch Hintergründe über die Verfehlungen bei der Lösung des Nationalitätenproblems.“
B(erliner) Z(eitung) am Abend vom 24. September 1981:
"Gisela Reller, Mitarbeiterin der Ilustrierten FREIE WELT, hat autonome Republiken und gebiete kleiner sowjetischer Nationalitäten bereist: die der Burjaten, Adygen und Karelier. Was sie dort ... erlebte und was Heinz Krüger fotografierte, ergíbt den informativen, soeben erschienenen Band Zwischen Weißem Meer und Baikalsee."
Sowjetliteratur (Moskau)Nr. 9/1982:
"(...) Das ist eine lebendige, lockere Erzählung über das Gesehene und Erlebte, verflochten mit dem reichhaltigen, aber sehr geschickt und unaufdringlich dargebotenen Tatsachenmaterial. (...) Allerdings verstehe ich sehr gut, wie viel Gisela Reller vor jeder ihrer Reisen nachgelesen hat und wie viel Zeit nach der Rückkehr die Bearbeitung des gesammelten Materials erforderte. Zugleich ist es ihr aber gelungen, die Frische des ersten `Blickes´ zu bewahren und dem Leser packend das Gesehene und Erlebte mitzuteilen. (...) Es ist ziemlich lehrreich - ich verwende bewusst dieses Wort: Vieles, was wir im eigenen Lande als selbstverständlich aufnehmen, woran wir uns ja gewöhnt haben und was sich unserer Aufmerksamkeit oft entzieht, eröffnet sich für einen Ausländer, sei es auch als Reisender, der wiederholt in unserem Lande weilt, sozusagen in neuen Aspekten, in neuen Farben und besitzt einen besonderen Wert. (...) Mir gefällt ganz besonders, wie gekonnt sich die Autorin an literarischen Quellen, an die Folklore wendet, wie sie in den Text ihres Buches Gedichte russischer Klassiker und auch wenig bekannter nationaler Autoren, Zitate aus literarischen Werken, Märchen, Anekdoten, selbst Witze einfügt. Ein treffender während der Reise gehörter Witz oder Trinkspruch verleihen dem Text eine besondere Würze. (...) Doch das Wichtigste im Buch Zwischen Weißem Meer und Baikalsee sind die Menschen, mit denen Gisela Reller auf ihren Reisen zusammenkam. Unterschiedlich im Alter und Beruf, verschieden ihrem Charakter und Bildungsgrad nach sind diese Menschen, aber über sie alle vermag die Autorin kurz und treffend mit Interesse und Sympathie zu berichten. (...)"
Neue Zeit vom 18. April 1983:
„In ihrer biographischen Skizze über den polnischen Pater Maksymilian Kolbe schreibt Gisela Reller (2. Auflage 1983) mit Sachkenntnis und Engagement über das Leben und Sterben dieses außergewöhnlichen Paters, der für den Familienvater Franciszek Gajowniczek freiwillig in den Hungerbunker von Auschwitz ging.“
Der Morgen vom 7. Februar 1984:
„`Reize lieber einen Bären als einen Mann aus den Bergen´. Durch die Sprüche des Kaukasischen Spruchbeutels weht der raue Wind des Kaukasus. Der Spruchbeutel erzählt auch von Mentalitäten, Eigensinnigkeiten und Bräuchen der Adygen, Osseten und Dagestaner. Die Achtung vor den Alten, die schwere Stellung der Frau, das lebensnotwendige Verhältnis zu den Tieren. Gisela Reller hat klug ausgewählt.“

1985 auf dem Solidaritätsbasar auf dem Berliner Alexanderplatz: Gisela Reller (vorne links) verkauft ihren „Kaukasischen Spruchbeutel“ und 1986 das extra für den Solidaritätsbasar von ihr herausgegebene Sprichwörterbuch „Dein Freund ist Dein Spiegel“.
Foto: Alfred Paszkowiak
Neues Deutschland vom 15./16. März 1986:
"Vor allem der an Geschichte, Bräuchen, Nationalliteratur und Volkskunst interessierte Leser wird manches bisher `Ungehörte´ finden. Er erfährt, warum im Kaukasus noch heute viele Frauen ein Leben lang Schwarz tragen und was es mit dem `Ossetenbräu´ auf sich hat, weshalb noch 1978 in Nukus ein Eisenbahnzug Aufsehen erregte und dass vor Jahrhunderten um den Aralsee fruchtbares Kulturland war, dass die Tschuktschen vier Begriff für `Freundschaft´, aber kein Wort für Krieg besitzen und was ein Parteisekretär in Anadyr als notwendigen Komfort, was als entbehrlichen Luxus ansieht. Großes Lob verdient der Verlag für die großzügige Ausstattung von Diesseits und jenseits des Polarkreises.“

Gisela Reller während einer ihrer über achthundert Buchlesungen
in der Zeit von 1981 bis 1991.
Berliner Zeitung vom 2./3. Januar 1988:
„Gisela Reller hat klassisch-deutsche und DDR-Literatur auf Liebeserfahrungen durchforscht und ist in ihrem Buch 666 und sex mal Liebe 666 und sex mal fündig geworden. Sexisch illustriert, hat der Mitteldeutsche Verlag Halle alles zu einem hübschen Bändchen zusammengefügt.“
Neue Berliner Illustrierte (NBI) Nr. 7/88:
„Zu dem wohl jeden bewegenden Thema finden sich auf 198 Seiten 666 und sex mal Liebe mannigfache Gedanken von Literaten, die heute unter uns leben, sowie von Persönlichkeiten, die sich vor mehreren Jahrhunderten dazu äußerten.“
Das Magazin Nr. 5/88.
"`Man gewöhnt sich daran, die Frauen in solche zu unterscheiden, die schon bewusstlos sind, und solche, die erst dazu gemacht werden müssen. Jene stehen höher und gebieten dem Gedenken. Diese sind interessanter und dienen der Lust. Dort ist die Liebe Andacht und Opfer, hier Sieg und Beute.´ Den Aphorismus von Karl Kraus entnahmen wir dem Band 666 und sex mal Liebe, herausgegeben von Gisela Reller und illustriert von Egbert Herfurth."
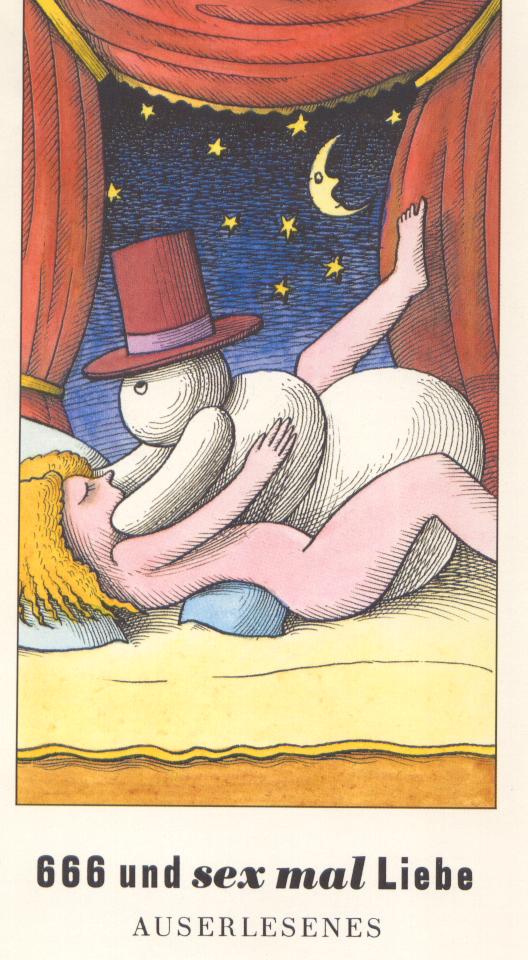
Schutzumschlag zum „Buch 666 und sex mal Liebe“
Zeichnung: Egbert Herfurth
FÜR DICH, Nr. 34/89:
"Dem beliebten Büchlein 666 und sex mal Liebe entnahmen wir die philosophischen und frechen Sprüche für unser Poster, das Sie auf dem Berliner Solidaritätsbasar kaufen können. Gisela Reller hat die literarischen Äußerungen zum Thema Liebe gesammelt, Egbert Herfurth hat sie trefflich illustriert."
Messe-Börsenblatt, Frühjahr 1989:
"Die Autorin – langjährige erfolgreiche Reporterin der FREIEN WELT - ist bekannt geworden durch ihre Bücher Zwischen Weißem Meer und Baikalsee und Diesseits und jenseits des Polarkreises. Diesmal schreibt die intime Kennerin der Sowjetunion in ihrem Buch Von der Wolga bis zum Pazifik über die Kalmyken, Tuwiner und die Bewohner von Sachalin, also wieder über Nationalitäten und Völkerschaften. Ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird uns in fesselnden Erlebnisberichten nahegebracht."
Im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel schrieb ich in der Ausgabe 49 vom 7. Dezember 1982 unter der Überschrift „Was für ein Gefühl, wenn Zuhörer Schlange stehen“:
„Zu den diesjährigen Tagen des sowjetischen Buches habe ich mit dem Buch
Zwischen Weißem Meer und Baikalsee mehr als zwanzig Lesungen bestritten. (…) Ich las vor einem Kreis von vier Personen (in Klosterfelde) und vor 75 Mitgliedern einer DSF-Gruppe in Finow; meine jüngsten Zuhörer waren Blumberger Schüler einer 4. Klasse, meine älteste Zuhörerin (im Schwedter Alten- und Pflegeheim) fast 80 Jahre alt. Ich las z.B. im Walzwerk Finow, im Halbleiterwerk Frankfurt/Oder, im Petrolchemischen Kombinat Schwedt; vor KIM-Eiersortierern in Mehrow, vor LPG-Bauern in Hermersdorf, Obersdorf und Bollersdorf; vor zukünftigen Offizieren in Zschopau; vor Forstlehrlingen in Waldfrieden; vor Lehrlingen für Getreidewirtschaft in Kamenz, vor Schülern einer 7., 8. und 10 Klasse in Bernau, Schönow und Berlin; vor Pädagogen in Berlin, Wandlitz, Eberswalde. - Ich weiß nicht, was mir mehr Spaß gemacht hat, für eine 10. Klasse eine Geographiestunde über die Sowjetunion einmal ganz anders zu gestalten oder Lehrern zu beweisen, dass nicht einmal sie alles über die Sowjetunion wissen – was bei meiner Thematik – `Die kleinen sowjetischen Völkerschaften!´ – gar nicht schwer zu machen ist. Wer schon kennt sich aus mit Awaren und Adsharen, Ewenken und Ewenen, Oroken und Orotschen, mit Alëuten, Tabassaranern, Korjaken, Itelmenen, Kareliern… Vielleicht habe ich es leichter, Zugang zu finden als mancher Autor, der `nur´ sein Buch oder Manuskript im Reisegepäck hat. Ich nämlich schleppe zum `Anfüttern´ stets ein vollgepacktes Köfferchen mit, darin von der Tschuktschenhalbinsel ein echter Walrosselfenbein-Stoßzahn, Karelische Birke, burjatischer Halbedelstein, jakutische Rentierfellbilder, eskimoische Kettenanhänger aus Robbenfell, einen adygeischen Dolch, eine karakalpakische Tjubetejka, der Zahn eines Grauwals, den wir als FREIE WELT-Reporter mit harpuniert haben… - Schön, wenn alles das ganz aufmerksam betrachtet und behutsam befühlt wird und dadurch aufschließt für die nächste Leseprobe. Schön auch, wenn man schichtmüde Männer nach der Veranstaltung sagen hört: `Mensch, die Sowjetunion ist ja interessanter, als ich gedacht habe.´ Oder: `Die haben ja in den fünfundsechzig Jahren mit den `wilden´ Tschuktschen ein richtiges Wunder vollbracht.´ Besonders schön, wenn es gelingt, das `Sowjetische Wunder´ auch denjenigen nahezubringen, die zunächst nur aus Kollektivgeist mit ihrer Brigade mitgegangen sind. Und: Was für ein Gefühl, nach der Lesung Menschen Schlange stehen zu sehen, um sich für das einzige Bibliotheksbuch vormerken zu lassen. (Schade, wenn man Kauflustigen sagen muss, dass das Buch bereits vergriffen ist.) – Dank sei allen gesagt, die sich um das zustande kommen von Buchlesungen mühen – den Gewerkschaftsbibliothekaren der Betriebe, den Stadt- und Kreisbibliothekaren, den Buchhändlern, die oft aufgeregter sind als der Autor, in Sorge, `dass auch ja alles klappt´. – Für mich hat es `geklappt´, wenn ich Informationen und Unterhaltung gegeben habe und Anregungen für mein nächstes Buch mitnehmen konnte.“Die Rechtschreibung der Texte wurde behutsam der letzten Rechtschreibreform angepasst.
Die
TUWINER wurden am 24.02.2014 ins Netz gestellt. Die letzte Bearbeitung erfolgte am 14.12.2015.www.reller-rezensionen.de gestattet - und mit korrekter Namensangabe des jeweils genannten geistigen Urhebers.Die Weiterverwertung der hier veröffentlichten Texte, Übersetzungen, Nachdichtungen, Fotos, Zeichnungen, Illustrationen... ist nur mit Verweis auf die Internetadresse
Zeichnung: Karl-Heinz Döhring